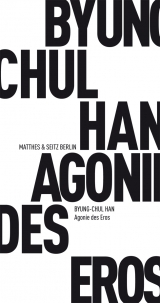 Die permanente Anstachelung zum sexuellen Begehren wie auch zum Warenkonsum scheint nie dagewesene Ausmaße zu erreichen. Die Allgegenwart von Sex in den Medien bedarf keiner Beispiele mehr. Was also kann Philosophieprofessor Byung-Chul Han im Sinn haben, wenn er vom Verschwinden des Eros, von einer heutigen „Gesellschaft ohne Eros“ spricht?
Die permanente Anstachelung zum sexuellen Begehren wie auch zum Warenkonsum scheint nie dagewesene Ausmaße zu erreichen. Die Allgegenwart von Sex in den Medien bedarf keiner Beispiele mehr. Was also kann Philosophieprofessor Byung-Chul Han im Sinn haben, wenn er vom Verschwinden des Eros, von einer heutigen „Gesellschaft ohne Eros“ spricht?
In etwa Folgendes: Die erotische Liebe im vollumfänglichen Sinne ist ein Wagnis zu einem Anderen hin, dessen Andersartigkeit sich stets ein Stück weit entzieht und die doch im Begehren leidenschaftlich bejaht wird. Die Hingabe, ja Auslieferung an dieses unkalkulierbare Bezogensein auf den Anderen kann eine transzendierende, aber auch destruktive Umwälzung bedeuten. In jedem Fall aber eine existentielle Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen. Eros im Sinne Hans ist das, was das Geheimnis, das Unverfügbare, das Dunkle und Nicht-Konsumierbare umfasst. „Ein besonderes Schwach-Werden erfasst das Subjekt der Liebe, das jedoch gleichzeitig von einem Gefühl der Stärke begleitet wird.“
Sich an den Anderen weggeben und dadurch neu zu sich selbst zurückkehren – das ist eine Bewegung, die, wie Han mit Verweis auf Emmanuel Lévinas richtig bemerkt, nur im Verzicht auf das Besitzen und Konsumieren des Anderen möglich ist. Genau aus diesem Grund verschwindet der Eros mit der – letztlich immer auch kommerziellen – Sexualisierung der Gesellschaft.
Aber wer ist schuld?
Han formuliert es philosophisch: Die Totalität der Immanenz, der Terror des Gleichen. Fast schon, man denke an Lévinas, ein religionsphilosphischer Befund. Die Folgen davon sind: Narzissmus, Depression, Ziellosigkeit, Mutlosigkeit, Entschlussunfähigkeit.
„Dem narzisstischen Subjekt erscheint die Welt nur in Abschattung seiner selbst. […] Das narzisstisch-depressive Subjekt ist erschöpft und zermürbt von sich selbst. Es ist weltlos und vom Anderen verlassen.“ Dieses Versinken in einem entgrenzten Ich korrespondiert mit einem affirmativem Kollektivplural (Yes, we can), mit dem sich die Leistungsgesellschaft weiter voranpeitscht. Doch, alle spüren es, hinter dem Tempowahnsinn, der das Leben vermeintlich intensiviert, macht sich ein Gefühl der Unwirklichkeit breit.
„Der Kapital- und Produktionsprozess beschleunigt sich dadurch ins Unendliche, dass er sich der Teleologie des guten Lebens entledigt.“ Das hat vor Han bereits der Soziologe Hartmut Rosa beschrieben und es ist schade, dass Han hier nicht tiefer einsteigt. Denn kaum ein Gegensatz trifft unsere Zeit so ins Mark wie der der produktionsgetriebenen Beschleunigung und Leistungsoptimierung bei gleichzeitiger geistig-seelischer Lähmung und der Empfindung, dass im Grunde nichts Neues mehr möglich sei. Alternativlosigkeit allerorten und in aller Munde.
„Obwohl nichts bleibt, wie es ist, ändert sich doch nichts Wesentliches mehr; hinter aller Buntheit verbirgt sich nur die Wiederkehr des Immergleichen, so lauten die Erstarrungsbefunde, die sich zu einer komplementären Kehrseite der Beschleunigungsdynamik verdichten“ (Hartmut Rosa: „Beschleunigung und Depression“, 2011).
„Wie möchten wir gelebt haben?“
Dies scheint als Frage nach dem Ziel unserer Geschäftigkeit zunehmend unverständlich angesichts glasklar bezifferbarer Sachzwänge. „Die Konsequenz eines Dauerdrucks ohne Zielhorizont“ aber sind Burnout- beziehungsweise Depressionserkrankungen. Oder wie es Lothar Baier formuliert: „Der Stupor [der Depressiven] gibt Kunde von dem öden Stillstand, der unter bunt animierten und von neuer Unübersichtlichkeit aufgelockerten Benutzeroberflächen gähnt“.
Alexis de Tocqueville beschrieb bereits vor fast 180 Jahren in „Über die Demokratie in Amerika“ in luzider Weise die Kehrseite der Egalität in Form entfesselter Konkurrenz: „Dieselbe Gleichheit, die jedem Bürger weitgespannte Hoffnungen erlaubt [nämlich aus eigener Kraft beliebig weit aufsteigen zu können], macht sämtliche Bürger als einzelne schwach. […] Sie haben die störenden Vorrechte einiger Mitmenschen abgeschafft; sie begegnen dem Wettstreit aller.“ Die neoliberal-kapitalistisch globalisierte Gesellschaft stellt dem Konkurrenten den Konsumenten als dominanten Typus zur Seite. Der Konsum indes befreit nicht von der narzisstischen Depression, sondern bläht das Ich weiter auf. Denn die Inbesitznahme ist gerade das Gegenteil einer wahrhaften Beziehung zum Anderen. Ohne die Andersartigkeit des Anderen ist, so Han, erotisches Begehren unmöglich, das Ich verbleibt im „Übermaß des Positiven“, in seiner „Hölle des Gleichen“. Erst „der Eros reißt das Subjekt aus sich heraus auf den Anderen hin“.
„Der Eros besiegt die Depression“,
so formuliert Han dann noch zweimal zitierfertig, streift damit aber auch nahe an der Tautologie entlang, insofern er Eros im wesentlichen als Beziehung zum Anderen versteht und Depression im wesentlichen als narzisstische Leere charakterisiert wird.
 Byung-Chul Han, Professor an der Berliner UDK, positioniert sich mit seinen Zeitgeistdiagnosen im Mini-Buch-Format erfolgreich im publizistischen Markt. Pointiert bis apodiktisch doziert er feuilletonnah über die Pathologien der spätkapitalistischen Gesellschaft. Das ZDF in Person des „aspekte“-Redakteurs Peter Schierings spricht mittlerweile bereits ironiefrei von einem „Philosophie-Star“ und „einem der radikalsten Denker des Landes“. Letzteres ist ein fast schon skurriles Missverständnis von Hans Texten. Denn radikal ist an ihnen allein ihre Kürze. Ansonsten leben sie vor allem von Zuspitzungen bereits prominent im Diskurs zirkulierender Thesen.
Byung-Chul Han, Professor an der Berliner UDK, positioniert sich mit seinen Zeitgeistdiagnosen im Mini-Buch-Format erfolgreich im publizistischen Markt. Pointiert bis apodiktisch doziert er feuilletonnah über die Pathologien der spätkapitalistischen Gesellschaft. Das ZDF in Person des „aspekte“-Redakteurs Peter Schierings spricht mittlerweile bereits ironiefrei von einem „Philosophie-Star“ und „einem der radikalsten Denker des Landes“. Letzteres ist ein fast schon skurriles Missverständnis von Hans Texten. Denn radikal ist an ihnen allein ihre Kürze. Ansonsten leben sie vor allem von Zuspitzungen bereits prominent im Diskurs zirkulierender Thesen.
Der Philosophie- oder Kulturkritik-DJ mixt die richtigen Autoren, unterlegt sie mit einem eigenen dichten Beat und gibt das Ergebnis schließlich in Popsonglänge heraus. Aber ja, das macht er gut. Und allein der keineswegs selbstverständliche Verweis auf das Denken Lévinas’ ist besondere Anerkennung wert:
In der Tat ist Byung-Chu Han mit seiner Gesellschaftstheorie auf den Spuren von Hegel und Lévinas zu einem der heimlichen Stars unter Deutschlands Philosophen geworden. Dieser Essay berichtet vom Verschwinden des Anderen und vom Todeskampf der Liebe in einer zunehmend übersättigten Gesellschaft. Wir seien, so Hans These in Anlehnung an sein erfolgreiches Buch über die Müdigkeitsgesellschaft, davon besessen, alles zu können. Die tragenden Säulen dieser Besessenheit seien Besitz, Erkenntnis und Leistung. Sie treiben den modernen Menschen mehr und mehr dazu, sich selbst auszubeuten.
Han greift auf das Gleichnis von Herr und Knecht zurück,
dies um zu zeigen, wie sehr wir uns in die Gefangenschaft unserer Wünsche begeben haben: Aus Furcht vor dem Tod klammerten wir uns nur noch an das bloße Leben und würden von einer totalen Gegenwart beherrscht. Die Such- und Kommunikationsmaschinen sind an die Stelle des Herrn getreten. Der Andere wird in dieser Hölle des Gleichen von uns bloß als konsumierbare Differenz wahrgenommen. Bestenfalls leiten uns die Maximen des Buchhalters: Datensteuerung und Repetition, Vergleich und Kalkulation. Das sei tödlich für alles Zwischenmenschliche. Die Fähigkeit zu lieben schwindet.
Einmal mehr kritisiert Han den Niedergang des Sozialen im 21. Jahrhundert. Nicht nur das Familiäre, auch der politische Alltag leide unter dieser Entwicklung.
Man muss diesem pointierten Essay nicht in allen Einzelheiten beipflichten, um zu erkennen, dass nur ein Funken Wahrheit in ihm uns zum Nachdenken über die Zukunft des Menschen bewegen sollte.
Byung-Chul Han: Agonie des Eros.
Matthes & Seitz Verlag, Berlin
73 Seiten, 10,00 EUR.
ISBN-13: 9783882219739
