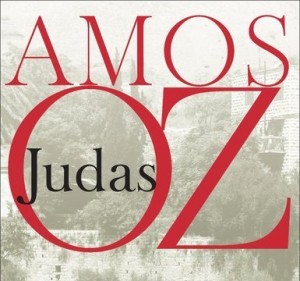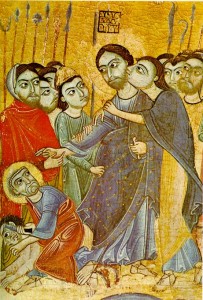 Der ungewöhnliche Blick auf Judas ist die wohl kühnste Position, die Oz in diesem Roman entwirft. Er füttert diese mit vielen Argumenten, etwa damit, dass Jesus gar nicht hätte durch seinen Kuss verraten werden müssen, weil ihn doch ohnehin jeder kannte. Auch die 30 Silberlinge als Belohnung für Judas, der keineswegs arm war, waren für ihn – ausnahmsweise mal neudeutsch – peanuts. Und sein Selbstmord leuchtet auch kaum mehr als garnicht ein.
Der ungewöhnliche Blick auf Judas ist die wohl kühnste Position, die Oz in diesem Roman entwirft. Er füttert diese mit vielen Argumenten, etwa damit, dass Jesus gar nicht hätte durch seinen Kuss verraten werden müssen, weil ihn doch ohnehin jeder kannte. Auch die 30 Silberlinge als Belohnung für Judas, der keineswegs arm war, waren für ihn – ausnahmsweise mal neudeutsch – peanuts. Und sein Selbstmord leuchtet auch kaum mehr als garnicht ein.
Aber, damit lässt Oz im Roman zwei Erzählstränge zusammenfinden, die von Judas Ischariot und von Schealtiel Abrabanel. Ihre Schicksale berühren Amoz Oz persönlich. Er selbst, sagte er im vergangenen November bei der Entgegennahme des erstmals vergebenen Siegfried-Lenz-Preises, sei oft als Verräter gescholten worden. Auch dafür, dass er einen (gewiss schmerzhaften) Kompromiss zwischen Israel und
Palästina suche. Manchmal, sagte Oz in seiner Hamburger Rede, sei der Titel „Verräter“ auch ein Ehrenabzeichen: „Manchmal ist der Verräter einfach eine Person, die den Mut zur Veränderung hat, in den Augen derer, die sich nicht verändern wollen, die Angst vor der Veränderung haben, die Veränderung hassen.“
Und die Liebe? Dafür ist im Roman die schöne Witwe zuständig. Dies jedoch nicht für die Erfüllung, sondern allenfalls für das Verlangen danach. Wald warnt Schmuel: „Verlieben Sie sich nicht in sie. Dafür haben Sie nicht die Kraft.“ Er spricht aus Erfahrung. Denn Schmuel ist nicht der erste Gesellschafter für Wald. Seine Vorgänger hielten es nie lange aus. Sie alle verliebten sich in Atalja, die Unnahbare mit der warmen Kälte, die alle Fremden fesselnd findet, so lange diese fremd sind. Gleichwohl entwickelt sie eine gewisse Sympathie für den unbeholfenen jungen Mann, der Papierschiffchen als Liebeszeichen faltet.
Schmuel kann – womit zu rechnen war – das „Rätsel Frau“ nicht lösen, was er durchaus mit dem weisen Wald gemein hat. Und auch mit Amos Oz, der weiland in seinem autobiografischen Roman „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“ (2002) bekannte, an der Auflösung bislang gescheitert zu sein.
Souverän gelingt es dem Autor Oz freilich, den drei Protagonisten Kontur und Ausstrahlung zu verleihen. Zugleich bleibt ihnen ein je eigenes Geheimnis, eine zweite Sphäre, die wir nicht durchdringen können. Unangestrengt spiegelt Oz die Motive Liebe, Verrat und Einsamkeit auf verschiedenen Ebenen.
Mögen wir auch drei Verlorene kennenlernen, mag auch keine Hoffnung sich zeigen, so ist dies doch ein leuchtender Roman. Und in vielerlei Hinsicht reich und sowohl melancholisch als auch komisch. Anregend und anrührend auf jeden Fall.
Und geschmeidig aus dem Hebräischen ins Deutsche übertragen von Mirjam Pressler, die mit „Judas“ für den Leipziger Buchpreis in der Kategorie Übersetzung nominiert worden ist.
Es passt zu diesem Roman der Einsamkeit, dass Schmuel am Ende mit dem Bus in die Negev-Wüste fährt. Nach vier Monaten verlässt er das Haus in der Rav-Albas-Gasse, das niemandem Glück zu bringen scheint und in dem nicht einmal mehr Träume von einem besseren Leben geträumt werden. Wohin er sich wenden wird? Vielleicht geht er in einen Kibbuz wie einst sein Schöpfer Amos Oz. Tatsächlich wirkt Schmuel einige Male wie ein Alter Ego des großen Autors – das gilt fürs Private, wenn er aus dem allzu engen Elternhaus flieht, wie fürs Politische. Oz, einer der prominentesten Vertreter der Friedensbewegung und der Zwei-Staaten-Lösung in seiner Heimat, lässt jetzt seinen Schmuel sagen: „Wenn es keinen Frieden gibt, werden uns die Araber eines Tages besiegen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und der Geduld.“ Und der Schuld?