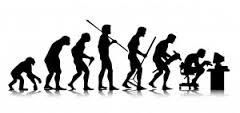Der Genetiker Steve Jones verkündet das Ende der menschlichen Evolution, moderne Chancengleichheit, eine signifikante Senkung der Kindersterblichkeit, das Ausdünnen despotischer Gesellschaftselemente und eine angebliche Zunahme an jungen Vätern – all diese Faktoren würden die Festigung des Status quo begünstigen, so seine These. Die Fachwelt ist skeptisch.
Kein Ende der Geschichte
Vor etwas mehr als 15 Jahren, unter dem Eindruck des Kollabierens der Sowjetunion und der Beilegung des Kalten Krieges, sorgte der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama für großes Aufsehen, als er kurzerhand und plakativ das Ende der Geschichte postulierte. Seine These, die von einem weltweiten Siegeszug der auf Marktwirtschaft basierenden Demokratie ausging, wurde vom unbändigen Geschichtsverlauf, welcher so gar keine Anstalten machte, das Feld zu räumen, für null und nichtig erklärt.
Ende der Evolution?
Heute, so scheint es, erlebt die dazumal rasch ad acta gelegte Debatte in abgewandelter Form eine Wiederauferstehung, wenngleich nicht mehr der Fortbestand der allgemeinen Geschichte als solcher in Zweifel gezogen, sondern nunmehr die biologische Weiterentwicklung des Menschen zur Disposition gestellt wird. Der britische Genetiker Steve Jones ließ unlängst mit einer pointierten Ansage aufhorchen: Die Evolution des Menschen sei aufgrund der vorherrschenden soziokulturellen Bedingungen in den westlichen Ländern, die prinzipiell eine Fortpflanzung aller fortpflanzungsfähigen Individuen ermöglichen würden, an einem Ende angelangt.
Sozialstaat vs. Auslese
Wenn man es recht betrachtet, so laufen diese Argumente nicht ganz ins Leere. Schließlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die klassischen Selektionsfaktoren durch moderne Gesellschaftssysteme, durch einen – wenngleich im Schwinden begriffenen – Sozialstaat, unterminiert werden. Aber selbst wenn der reproduktiven Fitness beim Menschen – d. h. dem Ausmaß, der sich auf den Fortpflanzungserfolg förderlich erweisenden Angepasstheit an die gegebenen Umweltbedingungen – in heutiger Zeit geringere Bedeutung beigemessen werden muss, dürfte die Evolution damit jedenfalls nicht außer Kraft gesetzt sein.
Pränatale Auslese
Der Evolutionsbiologe Thomas Junker von der Universität Tübingen verweist auf eine „massive pränatale Auslese“ im Mutterleib, der bis zu 30 % der Embryonen zum Opfer fallen. Für jene Embryos, die als Babys das Licht der Welt erblicken, bestehen zwar zweifellos sehr hohe Chancen, dereinst ins fortpflanzungsfähige Alter zu kommen, jedoch sagt dies wiederum wenig über die letztliche Reproduktionsrate dieser Individuen aus. Es ist naheliegenderweise davon auszugehen, dass auch die Partnersuche in unserer Gesellschaft einem „natürlichen“ Selektionsprozess unterliegt. Eine klare Bestimmung der in diesem Zusammenhang zentralen Faktoren erweist sich aber nicht zuletzt aufgrund einer weitgehenden Tabuisierung durch Gesellschaft und Wissenschaft als schwierig, wenngleich zweifellos, wie Junker weiter ausführt, „eine ganze Reihe von Eigenschaften, von der Gesundheit und körperlichen Attraktivität bis zu sozialen und geistigen Fähigkeiten, die den sexuellen Erfolg von Männern und Frauen beeinflussen“, vorliegt.
Mutationen im Alter
Um seine These vom Ende der humanen Evolution zu untermauern, beruft sich Jones zudem auf eine angebliche Zunahme an jungen Vätern in unserem Gesellschaftssystem, welche die Mutationsrate nach unten drücke und somit einer Veränderung des Genpools entgegenwirke. Zwar stimmt es, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Mutationen mit dem Alter zunimmt, es spricht jedoch ganz allgemein wenig dafür, dass es überhaupt zu einem prozentuellen Anstieg an jungen Vätern gekommen ist bzw. in absehbarer Zeit kommen wird. Gesicherte Daten sind hierzu aber nur sehr schwer zu erheben, zumal unsere Gesellschaft auch eine steigende Anzahl an unehelichen Kindern aufweist. Aus soziologischer Perspektive, so gibt die amerikanische Biologin Bobbi Low zu bedenken, scheint ein steigender Prozentsatz an jungen Vätern jedoch kaum mit unserem von stetig länger werdenden Ausbildungswegen gekennzeichneten Gesellschaftsmodell vereinbar.
„Big-time winner
Eine weitere Schwachstelle in Jones` Theoriegebäude wird durch Henry Harpending, seines Zeichens Distinguished Professor für Anthropologie an der Universität Utah, dessen eigene Forschungsarbeiten in scharfen Kontrast zu dem verkündeten Ende der Evolution stehen, offen gelegt. Harpending bemängelt die fehlende Berücksichtigung unterschiedlicher Fertilitätsraten bei Frauen. Aus evolutionärer Sicht, so erklärt der Professor, haben jene zwei Prozent der Frauen mit sieben oder mehr Kindern schließlich als „big-time winner“ zu gelten.
Kulturelle Evolution
Aber wie weit reicht nun eigentlich der Begriff der Evolution? Der sich unter anderem mit kulturanthropologischen Fragestellungen auseinandersetzende Philosoph Wolfgang Welsch macht sich in diesem Zusammenhang für eine grundsätzliche Trennung zwischen endogenen und exogenen Evolutionsfaktoren stark. Das bedeutet in weiterer Folge eine Unterscheidung zwischen biologischer und kultureller Evolution. Unter kultureller Evolution versteht man hierbei die Tradierung von Verhaltensweisen und Techniken innerhalb einer Population. Diese transgenerationelle Weitergabe von Information lässt sich überraschenderweise nicht nur beim Menschen vorfinden, sondern kann auch bei verschiedenen Tierarten konstatiert werden. Letztlich handelt es sich bei dieser kulturellen Evolution also um einen Lernprozess.
Es muss jedoch die Frage gestellt werden dürfen, ob eine klare Trennlinie zwischen biologischen und kulturellen Faktoren überhaupt gerechtfertigt erscheint. Neueren Forschungsergebnissen nämlich aus dem Bereich der Epigenetik zufolge hinterlässt schließlich auch der kulturspezifische Lebenswandel seine Spuren in unserem Erbmaterial. Folglich müssten zunächst der technologische Fortschritt bzw. unsere Kultur als Ganzes ihr Ende finden, bevor es überhaupt zu einem Aussetzten der Evolution kommen könnte.