Es ist ein Teil hiesiger Tradition, ein Wort wie Freiheit nicht für sich allein stehen zu lassen. Ruft da einer „Freiheit!“, schon gesellt ein anderer „Ordnung!“ dazu; wer da klug ist, redet gleich von „Freiheit und Verantwortung“ oder preist die Freiheit, warnt jedoch im gleichen Atemzug vor ihrem Missbrauch.
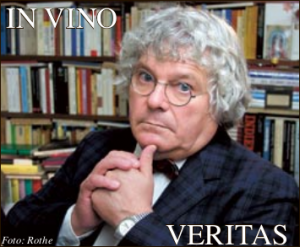 Häufig wird derzeit – aktuell Wahlkampfes wegen – der Vorwurf gemacht, Sprache werde im politischen Kontext beinahe reflexartig verwendet, fast automatisch werde im Wahlkampfendspurt auf Leerformeln zurückgegriffen, wo Konkretion und Präzision gefordert seien. Der Vorwurf, Sprache werde gelegentlich zur Manipulation eingesetzt, mithin von ihrer eigentlichen kommunikativen Aufgabe entfremdet, trifft sicher nicht nur den politischen Bereich. Sprachhülsige Plakate verunstalten derzeit Heidelbergs Straßen mit Wählerverblödungsabsichten – mehr Rente, wer hätte das nicht auch gerne. Oder bezahlbaren Wohnraum. Und so weiter … Und wenn dann noch ausgerechnet einer jener Rathaus-„Politiker“ fordert, die Ratssitzungen müssten via Internet in jede Wohnstube übertragen werden (nichts dagegen, im Gegenteil, aber): der seit Jahren beinahe ausschließlich Gestammel zu Wort bringt (aber wer von den Umworbenen weiß das schon?), dann grenzt ein solches Plakat schon beinahe ans Obszöne.
Häufig wird derzeit – aktuell Wahlkampfes wegen – der Vorwurf gemacht, Sprache werde im politischen Kontext beinahe reflexartig verwendet, fast automatisch werde im Wahlkampfendspurt auf Leerformeln zurückgegriffen, wo Konkretion und Präzision gefordert seien. Der Vorwurf, Sprache werde gelegentlich zur Manipulation eingesetzt, mithin von ihrer eigentlichen kommunikativen Aufgabe entfremdet, trifft sicher nicht nur den politischen Bereich. Sprachhülsige Plakate verunstalten derzeit Heidelbergs Straßen mit Wählerverblödungsabsichten – mehr Rente, wer hätte das nicht auch gerne. Oder bezahlbaren Wohnraum. Und so weiter … Und wenn dann noch ausgerechnet einer jener Rathaus-„Politiker“ fordert, die Ratssitzungen müssten via Internet in jede Wohnstube übertragen werden (nichts dagegen, im Gegenteil, aber): der seit Jahren beinahe ausschließlich Gestammel zu Wort bringt (aber wer von den Umworbenen weiß das schon?), dann grenzt ein solches Plakat schon beinahe ans Obszöne.
Wenn Sprache der Politik nicht der Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten dient sondern sich dem Verdacht aussetzt, sie diene eher der Verschleierung oder Verdunklung wahrer Absichten der Regierenden, der Abgeordneten, der Bürgermeister, der Gemeinderäte in spe, so ist das besonders schmerzlich.
System versucht Mehrheiten zu produzieren
Der Kampf der Politiker um Zustimmungsbereitschaft, die sprachlich erzeugt zu werden versucht, konzentriert sich auf eine bestimmte Spielart, auf diesem Sprachfeld erläutert handelnde Politik Ziele und Begründungen. Demokratie ist im Großen – ergo anderswo – wie im Kleinen hier in Heidelberg ein politisches System, das vom Gesetz der großen Zahl regiert wird. Dies System produziert Mehrheiten für politische Programme. Mehrheiten für Programme sollen schließlich auch Wahlergebnisse produzieren. Politiker in diesem unserem Lande machen den Fehler, Politik als Kunst des Möglichen zu begreifen, und nicht als die Kunst, das Notwendige möglich zu machen! Alsdann, zur Sache:
Bedeutet mehr Recht mehr Freiheit?
Die Funktion von Recht, durch Ordnung Freiheit zu eröffnen, ist nicht beliebig steigerungsfähig. Mehr Recht bedeutet (was Wunder) nicht notwendig mehr Freiheit, noch auch nur gesicherte Freiheit. Das Rezept „zweimal soviel ist doppelt so gut“ stimmt hier ebenso wenig, wie in der Medizin; „zuviel ist zuviel“, sagt schon Volkes Mund, und „mehr desselben“ kann des Guten bereits auch zuviel sein.
Mit zuviel Recht ginge nicht nur ein Funktionsverlust, sondern gingen geradezu Funktionsverkehrungen einher – eben jene, die man inzwischen ziemlich einhellig mit Verrechtlichung und Bürokratisierung in Zusammenhang bringt. Derweil Verrechtlichung nicht eben nur Wachstum des Rechts bedeutet, sondern eher einen Prozess bezeichnet, in welchem der intervenierende Staat einen neuartigen Rechtstyp, das „regulatorische Recht“, hervorbringt (Teubner 1984, 312). Damit einher geht als „Bürokratismus, als perfektionierte, übersteigerte Form der Bürokratie“ die schematisierte, ritualisierte, ohne Sinn-, Kosten und Leistungsüberlegung durchgeführte Arbeit in Verwaltungen. Spezifisches Bewußtsein von Beamtengruppen, die ihre Befugnisse, Anweisungsrechte und Einflußmöglichkeiten nicht in erster Linie zur kritischen Reflexion der sozialen Fakten und Zusammenhänge ihrer Arbeit, sondern zu ihrer eigenen Statusverbesserung anwenden.
Vollbürokratisiert ist eine Institution, wenn das büromäßige Verfahren und nicht mehr die Tätigkeit der Individuen – in der Justiz etwa: der Richter, der Staatsanwälte – die Abläufe in der Verwaltung prägt. (Es sei hierzu auch dringend ein Blick auf diese Internetseite empfohlen: www.richterdatenbank.org.)
Wem würde da nicht „warm ums Herz“, eingedenk eigener Erfahrungen als Bitt- und Antragsteller bei Ämtern und Behörden? Aber, es geht um mehr: Bürokratisierung und Verrechtlichung hängen hierzulande wirklich auf engste zusammen.
Wahrheit bleibt auf der Strecke
Daß man den Worten der Menschen nicht trauen kann, dieses Dilemma ist so alt wie die Sprache. Gleichermaßen unausrottbar wie die Lüge ist aber auch das Verlangen nach Wahrheit. Bei allen unzähligen Versuchen, Kontrollmöglichkeiten für sowohl die Verlässlichkeit von Aussagen, Erklärungen, Ehrenworten, Schwüren oder Vor-Wahlaussagen zu entwickeln, stehen Publikum und Richter immer noch dort, wo auch die Geschichte des Betrugs begann: vor dem Fiasko, dem Zusammenbruch. Dies zu ändern, müsste man schon die Schöpfung verklagen, was immerhin ein kleiner Gott aus dem dritten oder vierten Glied jener Unsterblichen im Mythos der Antike bereits wagte: Schon Momos hat nach dem Zeugnis Lukians einen der höchsten Götter, Hephaistos, den Designer des homo sapiens, dafür getadelt, dass er den Menschen kein gläsernes Fenster in die Brust gesetzt hat: So nämlich hätte man ihnen ins Herz blicken und ihre Wünsche und Gedanken beobachten können, um so die Wahrheit ihrer Worte zu überprüfen. Der Tadel blieb in der Evolution ohne erkennbare Wirkung.
Wahrheit & Fortschritt
Dazu, dass wir einem Politiker vertrauen, genügt(e) es häufig, dass er einer bestimmten Partei oder Konfession angehört. Ausfüllen aber können Politiker diese Funktion erst, nachdem wir sie mit jener magischen Kraft ausstatten,, die daraus erwächst, dass wir nämlich ihre Reden für wahr halten. Aber bitte, was ist das, die Wahrheit?
Das fragte bereits Pilatus seinen Angeklagten Jesus; eine uralte und offenbar unerschütterliche philosophische Tradition versteht unter Wahrheit die Abbildung der Wirklichkeit in der Sprache. Platon gab in seinem Dialog „Sophistes“ die Definition: „Wahrheit ist die kundige Nachahmung, die richtige Rede vom Seienden“. Mehr als zweitausend Jahre später nahm sich Wittgenstein in seinem „Tractatus logico-philosophicus“ des Themas an: „Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit“ – diese einander sehr ähnlichen Formulierungen müssen den Verdacht nähren dürfen, dass die Wissenschaft von der Wahrheit im Gang durch noch so viele Jahrhunderte keinen rechten Fortschritt gemacht habe.
Vertrauen ist gut …
Es wird doch nicht nur unser Verhältnis zu Politikern, sondern unser gesamtes Sozialverhalten durch eine Art treuherziger Vorleistung gesteuert, die simpel „Vertrauen“ genannt wird. Ohne Vertrauen, so erklären uns das Psychologen wie Gesellschaftswissenschaftler, könne überhaupt kein Sozialsystem funktionieren, nicht einmal die Straße würde man betreten, ohne die vertrauensvolle Sicherheit, Autos würden an einer roten Ampel auch wirklich halten …
Es vergibt das Vertrauen aber seinen Kredit nur solange, wie es nicht enttäuscht wird. Ein Verkehrsunfall kann mein Vertrauen in die Berechenbarkeit und Verlässlichkeit fremden Verhaltens gleichermaßen nachhaltig erschüttern wie das Verhalten von Politikern. Bereits der Staatsphilosoph Thomas Hobbes empfahl allen Herrschern („Leviathan“), in ihren (eigenen) Herzen zu lesen und zu erkennen, wie sehr die in die Herzen geschriebenen Wahrheiten befleckt sind von Heuchelei und Lüge. Was aber ist Vertrauen? Es ist die mehr oder weniger bewusste Annahme, dass, was eine Person über sich selbst und ihre Absichten gesagt hat, nicht alledem zuwiderhandelte.
Im Sinne also des Gottes Momos wäre Vertrauen die Erwartung, es spreche und handle ein jeder, als trüge er ein Fenster in der Brust. Sprechen und Handeln umfassen so allein das gesamte Spektrum sozialer Beziehungen. Und wenn in Gerichten „in dubio pro reo“ („im Zweifel für den Angeklagten“) zum Unwort mutiert, spricht das dann für eine funktionierende Justiz?
Mehr Recht = weniger Rechte = Kriminelle Vereinigungen
In dubio pro reo – zwar hat sich die deutsche Justiz immer und beharrlich geweigert, die SS als kriminelle Vereinigung im Sinne des §129 des Strafgesetzbuches zu behandeln, woselbst Mitgliedschaft allein schon strafbar ist, ohne dass dem einzelnen nachgewiesen werden muss, dass er noch andere Straftaten begangen, also etwa selbst getötet oder Beihilfe dazu geleistet hat. Das ist angesichts der Ermordung von sechs Millionen Juden und anderer Opfer eine beachtliche juristische Leistung, die allenfalls davon überboten (und ergänzt) wird, dass heute (zum Beispiel) Hausbesetzer nach dieser Vorschrift verfolgt werden …
Grundrechte werden hierzulande frei nach Markus 9, 43 ff ausgelichtet: „Wenn dich aber deine Hand zum Bösen verführet, so haue sie ab – desgleichen den Fuß. Und das Auge soll ausgerissen werden …“ Seit vielen Jahren betreiben die Bundesregierungen jeder Couleur Rechtspolitik nach diesem Rezept des Evangelisten: Rechte, die ein Ärgernis geben, werden abgeschlagen und ausgerissen. Und begründet wurde und wird das dann so: Auf nur diese Weise sei der Mißbrauch dieses Rechts zu verhindern. In der Tat arbeiten also unsere Politiker der inneren Sicherheit nach dem Amputationsprinzip.
Wann immer der Staat wirklich oder vermeintlich leidet, wird ein Recht amputiert – um so, angeblich, den Rechtsstaat wieder zu heilen. Haben wir uns an diese Methode bereits schon so sehr gewöhnt, dass Amputationen auch im Bereich der Grundrechte immer sorgloser vorgenommen werden? Der Bürger ist längst auch bei ihn betreffenden chirurgischen Eingriffen in einer schon unverantwortlich arglos zu nennenden Weise unbesorgt. Vielleicht beruhigt ja, dass, wie gesagt und geschrieben wird, zuviel Grundrecht ohnehin nur das Unrecht fördere.
Also, wenn wir’s recht verstehen, schneidet der Gesetzgeber dem Bürgerpatienten der Reihe nach die Gliedmaßen mit der Begründung weg, dass, was weg ist, auch nicht mehr weh tun könne.
Und, es heißt ja auch, wer nichts zu verbergen habe, der habe etwa bei der Vorratsdatenspeicherung bei alledem nichts zu befürchten. Genau nämlich damit begründen die Politiker der inneren Sicherheit all dies: das letzte, das neue, das nächste und das übernächste Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus. Staatlich verordnete Gesichtsvermessung, die zentrale Speicherung von Gesichts- und Fingerabdrücken, die exzessive Rasterfahndung, die Vermischung von Geheimdienst, Polizei und Militär, der Große Lauschangriff etc. pp.
Gemeinwesen & Philosophie
Es war eine der ersten großen abendländischen Kontroversen um die wahre Rede, die (400 v. Chr.) Platon mit den Sophisten führte, die der Nachwelt als philosophische Debatte gilt; im Kern aber betraf dieser Konflikt bereits die Verteilung und Organisation der Staatsmacht. Platons Sokrates ließ keine Gelegenheit aus, den Sophisten – die Rede zum käuflichen Gegenstand gemacht hatten – vorzuwerfen, sie verdürben und verführten die Jugend, indem sie rhetorische Trugbilder von der Welt und der Wahrheit verbreiteten. In der platonischen und sokratischen Kritik ist der Sophist ein Geschäftsmann, der bei seinen Zuhörern den Eindruck erwecke, seine Reden seien die „Wahrheit und nichts als die Wahrheit“, derweil Platon versprach, dass, habe sich der Staat erst einmal nach den Prinzipien der Gerechtigkeit aufgebaut, auch das Problem der Macht verschwinde.
Ein Gemeinwesen wird nicht durch unzählige Gesetze regiert, sondern durch Vertrauen auf das Hergebrachte. Isokrates, ein Zeitgenosse Platons, hat dieses Staatskonzept auf die Formel gebracht: „Bürger, die richtig regiert werden, bedürfen nicht der haufenweise auf Säulen geschriebenen Gesetze, sondern sie tragen die Gerechtigkeit geschrieben in ihren Herzen.“
Des Plato drei Elemente antisophistischer Kritik seien auch heute gültig wider den Betrug durch Missbrauch der Sprache, gegen die das Wahrheitsstreben ruinierende Profitgier und den Machtmissbrauch durch ein Übermaß an Vorschriften.
Wahrheit & Schriftgelehrte
Auch den Pharisäern und Schriftgelehrten war ja bekanntlich der Vorwurf nicht erspart geblieben, dass sie nur um des materiellen Vorteils wegen ihre Ämter ausübten (Matth. 23 und Luk. 11). Verfälschung der Wahrheit und Heuchelei und Lügen um des mammonal-finanziellen Interesses wegen, das waren schon damals die wesentlichen Anschuldigungen. Aber auch hier folgt die (sic) christliche Doktrin dem Vorbild der platonischen Polemik gegen die sophistische Legalität.
So schrieb Paulus – der Justitiar unter den Aposteln – im Römerbrief, alle überlieferten Gesetze taugten nichts, denn entweder wären die Menschen gerecht oder nicht. Er begründete seine Beweisführung damit, dass auch die Heiden das Gesetz Gottes aus natürlichem Antrieb befolgten. Ihnen sei das Gesetz ins Herz geschrieben (Römer 2,15); mithin habe die aufwendige Gesetzesauslegung der Juden wenig bis gar keinen Wert. Vergessen wir nicht, dass es bei der christlichen Revision der alten jüdischen Gesetzeslehre vor allem um Politik und um Macht ging. Die christliche Eroberung erst Europas und dann – ja, genau – der ganzen Welt, hat diese Tendenz unzweifelbar ins Licht gebracht. Wenn Weltpolitik damals wie heute und immerdar nach der christlichen Gesetzgebung im Namen Gottes geführt wurde, so geschah und geschieht das aus machttechnischen Notwendigkeiten: Wahrheit lockt Vertrauen aus der Reserve. Machiavelli hat das in seinen „Discorsi“ in unbekümmerter Deutlichkeit ausgesprochen: „Es gab tatsächlich noch nie einen außergewöhnlichen Gesetzgeber in einem Volk, der sich nicht auf Gott berufen hätte, weil seine Gesetze sonst nicht angenommen worden wären.“
Zurück in die Zukunft
Nach diesem Modell operierte auch Martin Luthers Reformation. In seiner Polemik gegen die römische Orthodoxie griff er just jene Formel auf, die bereits Jesus und Paulus gegen die jüdische Schriftverwaltung ins Feld geführt hatten. Die Lektüre seiner Reformationsschrift von 1520 „An den christlichen Adel deutscher Nation“ lässt überdeutlich erkennen, dass es ihm nicht nur um eine Kirchenreform, sondern allemal auch um eine Gesellschaftsreform ging.
Wahrheit & Politik
Bis heute zeigt die Geschichte der Wahrheit, dass die bisweilen sowohl Philosophen wie erst recht Politiker aus der Bahn werfende Macht nicht die einfache und banale Staatsmacht ist. Vielmehr haben wir es hier mit der Notwendigkeit zu tun, diese „Macht und die Herrlichkeit“ mit Zyklen und Wiederaufbereitungen des Wahren zu bemänteln. So wird das von Politikern alleweil gern gespielte Spiel simulierter Wahrheiten irgendwann tatsächlich wahr.
Und wer heute von Politikern Ehrlichkeit verlangt, darf nicht verdrängen, dass noch immer jede, in der Tat wirklich jede Wahrheit aus unzählbaren Wiederholungen auch von Lügen besteht.
Wahrheit zu guter Letzt:
Nennt man aber nicht gewöhnlich alle Mitglieder gesetzgebender Körperschaften ehrenwert? Was wäre da nun also neu?
Jürgen Gottschling

07.Mai.2014, 19:19
das passt ganz gut zu dem Artikel
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/media/zapp7411.html