Wenn Ronald Reagan der erste Teflon-Präsident war, dann ist Silicon Valley die erste Teflon-Industrie. Man kann sie mit noch so viel Schmutz bewerfen, nichts bleibt haften. Während „Big Pharma“, „Big Food“ und „Big Oil“ abwertende Ausdrücke sind, mit denen man die in diesen Branchen herrschende Gier beschreibt, gilt das für „Big Data“ nicht. Dieser unschuldige Ausdruck wird nie zur Kennzeichnung der gemeinsamen Ziele von Technologieunternehmen verwendet. Welcher gemeinsamen Ziele? Haben diese Leute denn nicht nur das eine Ziel, die Welt zu verbessern, Programmzeile für Programmzeile?
Wenn Ronald Reagan der erste Teflon-Präsident war, dann ist Silicon Valley die erste Teflon-Industrie. Man kann sie mit noch so viel Schmutz bewerfen, nichts bleibt haften. Während „Big Pharma“, „Big Food“ und „Big Oil“ abwertende Ausdrücke sind, mit denen man die in diesen Branchen herrschende Gier beschreibt, gilt das für „Big Data“ nicht. Dieser unschuldige Ausdruck wird nie zur Kennzeichnung der gemeinsamen Ziele von Technologieunternehmen verwendet. Welcher gemeinsamen Ziele? Haben diese Leute denn nicht nur das eine Ziel, die Welt zu verbessern, Programmzeile für Programmzeile?
Etwas Merkwürdiges geht hier vor. Uns ist klar, dass die Interessen von Unternehmen der Pharma-, Lebensmittel- und Ölindustrie selbstverständlich von unseren Interessen abweichen; aber Silicon Valley begegnen wir nur selten mit dem nötigen Misstrauen. Stattdessen behandeln wir Daten weiterhin so, als wären sie ein besonderes, geradezu magisches Gut, das sich ganz allein gegen jeden bösen Geist verteidigen könnte, der es auszubeuten droht.
Ein winziger Krater auf der rhetorischen Teflonschicht
Dieses Jahr zeigte sich ein winziger Kratzer auf der rhetorischen Teflonschicht von Silicon Valley. Die Snowden-Affäre hatte ihren Anteil daran, aber auch andere Ereignisse trugen dazu bei. Die Welt scheint endlich erkannt zu haben, dass der Ausdruck „Störung“ – das Lieblingswort der digitalen Eliten – ein ziemlich hässliches, schmerzhaftes Phänomen beschreibt. So klagen inzwischen Hochschullehrer über die „Störung“, die von den MOOCs (Massive Open Online Courses) ausgeht; Bewohner von San Francisco beklagen die „Störung“ der Mietpreise in einer Stadt, die sich plötzlich mit einer Invasion von Millionären konfrontiert sieht.
Jeder Jubel wäre verfrüht
Die Unzufriedenheit ist ermutigend. Sie könnte sogar dabei helfen, einige der um Silicon Valley gesponnenen Mythen zu begraben. Wäre es nicht schön, wenn wir eines Tages bei dem Satz, mit dem Google seine „Mission“ beschreibt, nämlich „alle Informationen der Welt zu organisieren und sie weltweit zugänglich und nutzbar zu machen“, endlich zwischen den Zeilen lesen und dessen wahre Bedeutung erkennen könnten, nämlich: „alle Informationen der Welt in Geld zu verwandeln und sie weltweit unzugänglich und profitabel zu machen“?
So gelangten wir womöglich zu der noch größeren emanzipatorischen Erkenntnis: Wenn wir zulassen, dass Google alle Informationen der Welt organisiert: Ist das nicht genauso sinnvoll, wie wenn wir zuließen, dass Halliburton das gesamte Erdöl der Welt organisiert? Jeder Jubel wäre verfrüht. Silicon Valley hat die Mechanik der öffentlichen Debatte immer noch fest im Griff. Solange unsere Kritik auf der Ebene der Technologie und der Information bleibt – einer Ebene, die man gemeinhin mit dem verhängnisvollen, bedeutungslosen und überstrapazierten Wort „digital“ umschreibt –, wird Silicon Valley weiter als außergewöhnliche, einzigartige Branche gelten.
Wenn Lebensmittelaktivisten sich gegen Big Food wenden und den Unternehmen vorwerfen, sie versähen ihre Produkte mit zu viel Salz und zu viel Fett, damit wir noch größeren Hunger darauf haben, dann wagt niemand, diese Aktivisten der Wissenschaftsfeindlichkeit zu bezichtigen. Eine ähnliche Kritik an Facebook und Twitter – zum Beispiel, sie hätten das Design ihrer Dienste so ausgelegt, dass sie mit unseren Ängsten spielen und uns zwingen können, ständig auf den Refresh-Button zu drücken, um das neueste Update zu erhalten – löst dagegen sofort den Vorwurf der Technikfeindlichkeit und des Maschinensturms aus.
In Silicon Valley mag man keine Plurale
Der Grund, weshalb die digitale Debatte so leer und zahnlos wirkt, ist einfach: Da sie als Debatte über „das Digitale“ statt über „das Politische“ oder „das Ökonomische“ einherkommt, wird sie mit Begriffen geführt, die den Technologieunternehmen von vorneherein nützen. Ohne dass die meisten sich dessen bewusst wären, ist der scheinbar außergewöhnliche Status der betreffenden Güter – von „Information“ über „Netzwerke“ bis zum „Internet“ – unserer Sprache bereits eincodiert.
Diese verborgene Außergewöhnlichkeit erlaubt es Silicon Valley, seine Kritiker als Maschinenstürmer abzutun, die sich gegen „Technologie“, „Information“ oder „das Internet“ wenden – in Silicon Valley mag man keine Plurale, weil Nuancen den Verstand zu überfordern drohen – und deshalb auch gegen „Fortschritt“ sein müssen.
Woran können Sie die „digitale Debatte“ erkennen? Schauen Sie nach Argumenten, die sich auf das Wesen der Dinge berufen – das Wesen der Technologie, der Information, des Wissens und natürlich des Internets. Wenn Sie jemanden sagen hören: „Dieses Gesetz ist schlecht, weil es das Internet zerstört“, oder: „Dieses neue Gerät ist gut, weil die Technologie es verlangt“, dann wissen Sie, dass Sie den Bereich des Politischen verlassen haben und in den Bereich schlechter Metaphysik geraten sind.
Der wahre Feind ist nicht die Technologie
In diesem Bereich verlangt man von Ihnen, sich fürs Wohlergehen digitaler Phantomgüter einzusetzen, die doch nur für die Unternehmensinteressen stehen. Wie kommt es, dass etwas, das möglicherweise „das Internet zerstört“, auch Google zu zerstören droht? Das kann kein Zufall sein, oder? Vielleicht sollten wir die Dialektik von Technologie und Fortschritt gänzlich über Bord werfen. „Ist es in Ordnung, ein Maschinenstürmer zu sein?“, lautete der Titel eines großartigen, 1984 veröffentlichten Essays von Thomas Pynchon – ein Frage, die er alles in allem mit „ja“ beantwortete. Diese Frage scheint heute überholt. Heute fragte man besser: „Ist es in Ordnung, kein Maschinenstürmer zu sein und dennoch Silicon Valley zu hassen?“
Denn der wahre Feind ist nicht die Technologie, sondern das gegenwärtige politische und wirtschaftliche Regime – eine wilde Kombination aus dem militärisch-industriellen Komplex, dem außer Kontrolle geratenen Bankenwesen und der Werbewirtschaft –, ein Regime, das die neueste Technologie einsetzt, um seine hässlichen (wenn auch lukrativen und zuweilen angenehmen) Ziele zu erreichen. Silicon Valley ist der sichtbarste, am meisten diskutierte und naivste Teil dieses Gefüges. Kurz, es ist in Ordnung, Silicon Valley zu hassen – wir müssen es nur aus den richtigen Gründen tun. Unten sind drei davon aufgeführt – aber es dürfte sich kaum um eine vollständige Liste handeln.
Grund Nummer eins: Silicon-Valley-Firmen umgeben unser Leben mit einem, wie ich es nennen möchte, „unsichtbaren Stacheldrahtzaun“. Man verspricht uns mehr Freiheit, mehr Offenheit, mehr Mobilität; man sagt uns, wir könnten umherstreifen, wo immer und wann immer wir wollten. Aber die Art von Freiheit, die wir wirklich erhalten, ist nur eine Scheinfreiheit: die Freiheit eines gerade entlassenen Kriminellen, der eine Fußfessel trägt.
Der unsichtbare Stacheldrahtzaun in der Praxis
Ein sich selbst lenkendes Auto könnte durchaus unsere Fahrt zur Arbeit weniger gefährlich machen. Aber ein sich selbst lenkendes Auto, das von Google betrieben würde, wäre nicht einfach ein sich selbst lenkendes Auto; es wäre ein Schrein für die Überwachung auf Rädern. Es würde genauestens aufzeichnen, wohin wir fahren. Es könnte uns sogar daran hindern, an bestimmte Orte zu fahren, wenn unsere – durch eine Analyse unseres Gesichtsausdrucks ermittelte – Stimmung den Verdacht nahelegt, dass wir zu zornig oder zu müde oder zu emotional sind.
Das sind natürlich Ausnahmen. Gelegentlich fühlt GPS sich befreiend an. Aber der Trend ist klar: Jeder weitere Google-Sensor im Auto bedeutet einen weiteren Kontrollhebel. Dieser Hebel müsste gar nicht eingesetzt werden, um seine Wirkung zu entfalten. Unser Wissen, dass er da ist, würde genügen. Gilles Deleuze hat 1990 in einem Gespräch mit Toni Negri gesagt: „Angesichts der kommenden Formen permanenter Kontrolle im offenen Milieu könnte es sein, dass uns die härtesten Internierungen zu einer freundlichen und rosigen Vergangenheit zu gehören scheinen.“
Dieser Zusammenhang zwischen der scheinbaren Offenheit unserer technologischen Infrastruktur und einer Verschärfung der Kontrolle ist bis heute nicht recht verstanden. Was bedeutet der unsichtbare Stacheldrahtzaun in der Praxis? Nehmen wir an, Sie möchten Vegetarier werden. Sie gehen zu Facebook und suchen mit Hilfe von Graph Search nach den Lieblingsrestaurants all ihrer in der Nähe wohnenden Freunde. Facebook erkennt, dass Sie vor einer wichtigen Entscheidung stehen, die mehrere Branchen betreffen wird: eine gute Nachricht für Tofu-Hersteller und eine schlechte Nachricht für die Fleischabteilung Ihres Supermarkts.
Dem Höchstbietenden ausgeliefert
Facebook wäre dumm, wenn es von diesem Wissen nicht profitierte. Es organisiert eine Anzeigenauktion, um festzustellen, ob die Fleischindustrie sich mehr von Ihnen verspricht als die Tofu-Hersteller. Von nun an liegt Ihr Schicksal nicht mehr in Ihren Händen. Das klingt verrückt – bis Sie in Ihren Supermarkt gehen, und Ihr Smartphone zeigt ihnen an, dass die Fleischabteilung Ihnen einen Rabatt von zwanzig Prozent gewährt. Am nächsten Tag gehen Sie an einem Steakhouse in Ihrer Nachbarschaft vorbei, und Ihr Smartphone summt schon wieder: Auch hier bietet man Ihnen Rabatt an. Kommen Sie herein und essen Sie ein Steak!
Nach einer Woche des Überlegens – und massenweise billigen Fleischs – beschließen Sie, dass die vegetarische Ernährung doch nicht Ihr Ding ist. Damit ist die Sache abgeschlossen. Hätte die Tofu-Branche die Auktion gewonnen, hätten sich die Dinge natürlich auch in die andere Richtung entwickeln können. Aber es kommt nicht darauf an, wer die Auktion gewinnt. Entscheidend ist, dass eine Entscheidung, die vollkommen autonom erscheint, gar nicht autonom ist. Sie haben das Gefühl größerer Freiheit und Macht. Aber das ist lächerlich: Sie sind einfach dem Höchstbietenden ausgeliefert.
Und geboten wird hier um die Möglichkeit, mit einer aussichtsreichen Werbung an Sie heranzutreten, einer Werbung, die auf allem basiert, was Facebook über Ihre Ängste und Unsicherheiten weiß. Das hat nichts mehr mit der nichtssagenden, eindimensionalen Werbung zu tun. Das Beispiel ist keineswegs das Produkt meiner wilden Phantasie. Im vergangenen Jahr hat Facebook einen Vertrag mit einer Firma namens Datalogix geschlossen, der es dem Unternehmen ermöglichen soll, eine Verbindung zwischen Ihren Einkäufen im örtlichen Supermarkt und der Werbung herzustellen, die Facebook Ihnen zeigt.
Jeder Aspekt des täglichen Lebens wird in produktives Kapital verwandelt
Google hat bereits eine App (Google Field), die Geschäfte und Restaurants in Ihrer Gegend ständig nach Ihren letzten Einkäufen absucht. Nichts an diesem Beispiel hängt mit irgendeinem Hass auf Technologie oder Information zusammen. Es geht vielmehr um politische Ökonomie, Werbung, Autonomie. Was hat das mit der „digitalen Debatte“ zu tun? Sehr wenig. Das datenzentrierte Modell des Silicon-Valley-Kapitalismus versucht, jeden Aspekt unseres alltäglichen Lebens – was einmal unsere eigene Atempause von den Wechselfällen der Arbeit und den Ängsten des Marktes war – in produktives Kapital zu verwandeln.
Das geschieht nicht nur durch eine Verwischung der Grenze zwischen Arbeit und Nichtarbeit, sondern auch, indem man uns drängt, stillschweigend zu akzeptieren, dass unser Ruf ein work in progress ist, etwas, an dem wir rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche feilen können und sollen. Deshalb verwandelt man alles in produktives Kapital: unsere Beziehungen, unser Familienleben, unseren Urlaub, unseren Schlaf (inzwischen werden wir sogar zum „sleep-hacking“ aufgefordert, damit wir in der kürzesten Zeit möglichst viel Schlaf finden können). Noch nie hat Fortschritt sich so gut angefühlt: Wer arbeitet nicht lieber sieben Tage die Woche rund um die Uhr als fünf Tage die Woche acht Stunden am Tag?
Grund Nummer zwei: Silicon Valley hat unsere Fähigkeit zerstört, uns andere Modelle für Organisation und Betrieb unserer Kommunikationsinfrastruktur vorzustellen. Vergessen Sie Modelle, die nicht auf Werbung basieren und keinen Beitrag zur Zentralisierung von Daten auf privaten Servern in den Vereinigten Staaten leisten. Wer sagt, wir müssten uns nach anderen, vielleicht sogar öffentlich-rechtlich verfassten, Alternativen umschauen, riskiert den Vorwurf, er wolle „das Internet zerstören“.
Die „Diktatur der Alternativlosigkeit“
Wir sind der „Diktatur der Alternativlosigkeit“ erlegen, wie der brasilianische Gesellschaftstheoretiker Roberto Unger dies genannt hat. Wir sollen akzeptieren, dass Gmail der beste und einzig mögliche Weg zum Verschicken von E-Mails und Facebook der beste und einzig mögliche Weg zum Social-Networking sei. Nach dem NSA-Skandal hat das Vertrauen in staatliche Institutionen solch einen Tiefstand erreicht, dass alle alternativen Lösungen undenkbar erscheinen – vor allem solche, in denen staatliche Einrichtungen eine größere Rolle spielten.
Aber das ist nur ein Teil des Problems. Was würde geschehen, wenn einige Teile unserer hochgeschätzten und privat betriebenen digitalen Infrastruktur zerfielen, weil Unternehmen sich weiterentwickeln und ihr Geschäftsmodell wechseln? Vor fünf Jahren konnte man noch dumme kleine Bücher mit Titeln wie „Was würde Google tun?“ herausbringen, die auf der Annahme basierten, das Unternehmen hätte eine konsistente und weitgehend wohltätige Philosophie und sei bereit, unprofitable Dienste zu subventionieren, nur weil es sich das leisten konnte. Seit Google seinen Google Reader und viele andere beliebte Dienste eingestellt hat, kann man von solcher Wohltätigkeit nicht mehr ausgehen.
In den nächsten zwei oder drei Jahren dürfte Google ankündigen, dass man Google Scholar, einen kostenlosen, aber völlig unprofitablen Dienst, vom dem Millionen von Wissenschaftlern weltweit profitieren, einstellen wird. Warum bereiten wir uns nicht auf diese Möglichkeit vor und bauen eine robuste, staatlich gestützte Infrastruktur auf? Klingt es nicht lächerlich, dass Europa zwar ein Projekt wie Cern realisiert, aber unfähig zu sein scheint, einen Online-Dienst zu schaffen, der es ermöglicht, Aufsätze über das Cern ausfindig zu machen? Könnte der Grund darin liegen, dass Silicon Valley uns überzeugt hat, es wäre eine magische Industrie?
Entscheidend ist, dass die Privatsphäre teuer wird
Nachdem unsere Kommunikationsnetze in private Hände gelangt sind, sollten wir nicht denselben Fehler bei der Privatsphäre machen. Wir sollten diese komplexe Problematik nicht auf marktgestützte Lösungen reduzieren. Aber dank des unternehmerischen Eifers von Silicon Valley wird auch die Privatsphäre zu einer Ware. Wie sichert man heute seine Privatsphäre? Da müssen Sie einen Hacker fragen: Nur indem man lernt, wie die richtigen Tools funktionieren. Die Privatsphäre ist nicht mehr selbstverständlich gegeben oder gar kostenlos zu haben. Man muss einige Ressourcen opfern, um die einschlägigen Tools zu beherrschen.
Diese Ressourcen können in Geld, Geduld oder Aufmerksamkeit bestehen, Sie können sogar Berater anheuern, die all das für Sie erledigen. Entscheidend ist, dass die Privatsphäre teuer wird. Und was ist mit denen, die sich keine Tools oder Berater leisten können? Wie verändert sich deren Leben? Wenn der Gründer einer bekannten neuen Kreditgesellschaft – kein Geringerer als der ehemalige Chief Information Officer (CIO) von Google – erklärt: „Alle Daten sind Kreditdaten, wir wissen nur noch nicht, wie wir sie richtig einsetzen“, dann kann man nur das Schlimmste befürchten.
Wenn „alle Daten Kreditdaten“ sind und Arme sich keine Privatsphäre mehr leisten können, kommen dunkle Zeiten auf sie zu. Wie sollte ihnen nicht angst und bange werden, wenn jede Bewegung, jeder Klick, jedes Telefongespräch analysiert werden kann, um vorauszusagen, ob sie einen Kredit verdienen und, wenn ja, zu welchen Zinsen? Als ob die Schuldenlast nicht lähmend genug wäre, werden wir nun mit der Tatsache leben müssen, dass für Arme die Angst lange vor der eigentlichen Kreditgewährung beginnt.
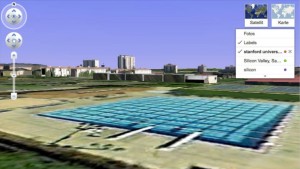

 © Google Earth
© Google Earth