 Der Cheftheoretiker des kommunikativen Handelns, Jürgen Habermas, und der Vorsitzende der katholischen Glaubenskongregation, Joseph Kardinal Ratzinger, saßen am 19. Januar 2004 auf einem Podium der Katholischen Akademie Bayern in München und sprachen über „Vorpolitische Grundlagen eines freiheitlichen Staates“. In der Presse war anschließend von einem „Gespräch“, von einem „Dialog“ die Rede. Auch im Vorwort des dieses Ereignis dokumentierenden Bandes spricht der Herausgeber Florian Schuller, Chef der Katholischen Akademie Bayern, von „Gespräch“ und „Dialog“. Es mag damals in München dazu gekommen sein. Zu lesen gibt es jetzt kein Gespräch, keinen Dialog, sondern – was Wunder – zwei Vorträge. Direktor Schuller findet sie spannend, aber ganz sicher hätte auch er einen Dialog spannender gefunden. Schon um zu sehen, wie einer, dessen Aufgabe es ist, die Wahrheit, die einzig mögliche Wahrheit, zu vertreten, debattieren kann mit jemandem, dem sich die Wahrheit, so wird er jedenfalls nicht müde zu schreiben, erst erschließt in der Auseinandersetzungen mit den vielen Wahrheiten. Die „Anschlussfähigkeit“ eines professionellen Dogmatikers wäre zu vergleichen gewesen mit der des Dogmatikers der Anschlussfähigkeit.
Der Cheftheoretiker des kommunikativen Handelns, Jürgen Habermas, und der Vorsitzende der katholischen Glaubenskongregation, Joseph Kardinal Ratzinger, saßen am 19. Januar 2004 auf einem Podium der Katholischen Akademie Bayern in München und sprachen über „Vorpolitische Grundlagen eines freiheitlichen Staates“. In der Presse war anschließend von einem „Gespräch“, von einem „Dialog“ die Rede. Auch im Vorwort des dieses Ereignis dokumentierenden Bandes spricht der Herausgeber Florian Schuller, Chef der Katholischen Akademie Bayern, von „Gespräch“ und „Dialog“. Es mag damals in München dazu gekommen sein. Zu lesen gibt es jetzt kein Gespräch, keinen Dialog, sondern – was Wunder – zwei Vorträge. Direktor Schuller findet sie spannend, aber ganz sicher hätte auch er einen Dialog spannender gefunden. Schon um zu sehen, wie einer, dessen Aufgabe es ist, die Wahrheit, die einzig mögliche Wahrheit, zu vertreten, debattieren kann mit jemandem, dem sich die Wahrheit, so wird er jedenfalls nicht müde zu schreiben, erst erschließt in der Auseinandersetzungen mit den vielen Wahrheiten. Die „Anschlussfähigkeit“ eines professionellen Dogmatikers wäre zu vergleichen gewesen mit der des Dogmatikers der Anschlussfähigkeit.
Dieses Vergnügen bietet uns das kleine Büchlein nicht. Dafür findet sich allerhand Rührendes. Habermas zum Beispiel schreibt: „Säkularisierte Bürger dürfen, soweit sie in ihrer Rolle als Staatsbürger auftreten, weder religiösen Weltbildern grundsätzlich ein Wahrheitspotential absprechen, noch den gläubigen Mitbürgern das Recht bestreiten, in religiöser Sprache Beiträge zu öffentlichen Diskussionen zu machen.“ Gegen wen wendet sich Habermas? Gibt es jemanden, der gefordert hat, gläubigen Christen den Mund zu verbieten? Wen oder was meint Habermas? Was heißt „Rolle als Staatsbürger“? Ist es nicht schon demokratietheoretisch äußerst fragwürdig im Falle des Staatsbürgers von einer „Rolle“ zu sprechen? Und erst in der Praxis: Äußert sich ein Professor in einer Tageszeitung zu einem aktuellen politischen Problem in seiner „Rolle als Staatsbürger“? Tut er das nicht, wenn er dasselbe am Stammtisch sagt? Wann bin ich Staatsbürger, wann nicht? Redet Habermas in der Akademie als Staatsbürger oder als Wissenschaftler? Religiösen Weltbildern darf man nicht grundsätzlich ein Wahrheitspotential absprechen?
Was ist Wahrheit? Wenn sie etwas mit Forschung, mit Analyse und Untersuchung zu tun hat, dann muss man religiösen Weltbildern, sicher nicht in jedem Detail, aber doch grundsätzlich ein „Wahrheitspotential“ – was ist das? – absprechen. „Wahrheitspotential“ sagt doch nur: Wir müssen, wenn wir mit jemandem sprechen, davon ausgehen, dass er die Wahrheit sagen könnte. Das ist in jedem Fall vernünftig.
Vorausgesetzt man hat sehr viel Zeit. Wenn man freilich hört, das Gegenüber vertritt allen Ernstes die Auffassung, vor zweitausend Jahren habe in einem kleinen Ort im Nahen Osten eine Jungfrau – unter dem Jubel von den Himmel bevölkernden Engeln – ein Kind geboren, dann wird man – es sei denn man hat im Augenblick nichts Interessanteres zu tun – abwinken und nicht mehr lange über ein mögliches „Wahrheitspotential“ dieser Auffassung nachdenken. Es sei denn, man ist in einem christlichen Milieu aufgewachsen, dann nimmt man derartige Äußerungen als das Natürlichste von der Welt, wie Regen oder Schnee. Sowie aber jemand kommt und behauptet am 18. Juni 1929 sei in Düsseldorf der Erlöser geboren worden, wird auch Habermas dem Vertreter dieser Religion das Wahrheitspotential absprechen.
Der Witz beim religiösen Weltbild ist nicht, dass es die Vernunft bezweifelt und daran erinnert, dass hinter dem Wenigen, das wir wissen, noch ganz und großartig Anderes zu vermuten ist. Das wäre kein Bild, sondern eine black box. Das religiöse Weltbild weiß oder behauptet zu wissen. Es behauptet nicht nur zu wissen, dass es einen Gott gibt, sondern auch zu wissen, was er will, was er mag, was ihm missfällt. Hätte Jürgen Habermas sich die Mühe gemacht, das Wahrheitspotential in einigen der seit Jahrtausenden herrlich ausgepinselten Ansichten vom al di la des Katholizismus – zum Beispiel bei der Jungfrauengeburt, bei der Schöpfungsgeschichte oder beim Jüngsten Gericht – uns plausibel zu machen, er hätte unsere Bewunderung, oder wir wüssten doch wenigstens, was er sich vorstellt, wenn er vom Wahrheitspotential religiöser Weltbilder spricht.
Man darf, meint Habermas, auch religiösen „Mitbürgern nicht das Recht bestreiten, in religiöser Sprache Beiträge zu öffentlichen Diskussionen zu machen“. Uns ist nicht auch nur ein Fall bekannt, in dem jemand Redeverbot bekam, weil er in „religiöser Sprache“ sich äußerte. Aber, was heißt „religiöse Sprache“? Und was heißt, „das Recht bestreiten“? Ist „das ist der Wille Gottes“ – religiöse Sprache? Wir haben das oft gehört. Damit sollten Diskussionen abgebrochen, beendet werden. Die Pastoren, die so sprechen, haben alles Recht der Welt so zu reden. Nur dürfen sie nicht verlangen, das als ein Argument zu akzeptieren. Wir nehmen uns das Recht, das zu hinterfragen. WIr haben sogar die Pflicht dazu. Habermas‘ Ausführungen sind fast so unklar wie die des damaligen Kardinals und heutigen Papstes. Dabei hat niemand Habermas gezwungen, zwei Herren zu dienen.
Josef Ratzinger ist in dieser Disziplin seit Jahrzehnten im Training. Seine Aufgabe war, die Lehre rein zu halten. Also alles zu verdrängen, zu bannen und zu ächten, was ihr widersprach oder ihr – zu Ende gedacht – doch hätte widersprechen können. Das ist eine niemals endende Arbeit. Die Anfechtungen sind riesig. Sie kommen vom Gefühl und vom Verstand. Wer nicht an die Jungfräulichkeit der Maria glaubt, liegt verkehrt, wer aber an sie glaubt, statt an den dreieinigen Gott, der ist auch zu verdammen. Es ist eine Welt, die nur aus Fallstricken besteht, und jeder käme darin zu Fall. Da ist es schon besser, man bestimmt selbst, wie die Strippen zu ziehen sind. Wer die jüngsten Eskapaden des Wiener Kardinals Christoph Schönborn in Sachen Evolutionstheorie für dessen Steckenpferd hielt, der wird nach einem Blick in Ratzingers Rede eines Besseren belehrt: „Die Idee des Naturrechts setzte einen Begriff von Natur voraus, in dem Natur und Vernunft ineinander greifen, die Natur selbst vernünftig ist. Diese Sicht von Natur ist mit dem Sieg der Evolutionstheorie zu Bruche gegangen. Die Natur als solche sei nicht vernünftig, auch wenn es in ihr vernünftiges Verhalten gibt.“
Man versteht diese Sätze Ratzingers nicht, wenn man nicht begreift, dass er gerade nicht die Vernunft als etwas Natürliches sehen möchte – das wäre die Sicht eines Evolutionisten -, sondern vielmehr die Natur als etwas der Vernunft, die er in eins setzt mit seinem Gott, Gehorchendes, ihr Unterworfenes oder doch zu Unterwerfendes betrachtet. Darüber zu streiten, macht freilich keinen Spaß, weil der Kardinal an keiner Stelle seiner Ausführungen – er ist dem deutschen Soziologiepapst da nicht unähnlich – sich in die Niederungen überprüfbarer Ansichten begibt. Besonders erheiternd ist diese über alles mehr verfügende als sich mit ihm auseinandersetzende Sicht auf die Welt, wenn Kardinal Ratzinger das Weltethos-Projekt seines einstigen Kollegen Küng mit der Begründung ablehnt, die „kulturellen Kontexte“ seien zu unterschiedlich als dass die Menschheit sich darauf einigen könnte. Die eine allumfassende, die katholische Kirche – mit ihrem 824seitigen Katechismus – soll möglich sein, der Einigung darüber aber, dass man einander nicht umbringt, der stehen die Unterschiede der Kulturen im Wege! got
Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger: „Dialektik der Säkularisierung – Über Vernunft und Religion“. Vorwort und Herausgeber: Florian Schuller. Herder Verlag, Freiburg, 64 Seiten, 9,90 Euro. ISBN 3451288699.
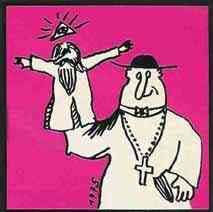

08.Apr..2011, 11:00
Danke got!
An ihrem Unfug sollt Ihr sie erkennen.
Für jeder Argument-Kette gilt: Ist eine der Aussagen falsch (oder sinnlos!), dann werden auch alle andere Aussagen davon infiziert.
=> Wir Vernünftigen hören schon seit 1000 Jahre den Pfaffen nicht mehr zu.