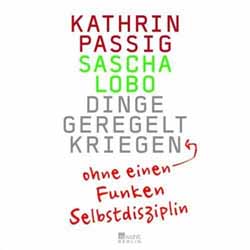Von Zeit zu Zeit vergessen wir, vor lauter Frauenquote und Gender-Mainstreaming, dass „Emanzipation“ ebenso schlicht wie gewichtig „Befreiung“ bedeutet. Mit „Der letzte Patriarch“ legt der Wagenbach-Verlag einer hoffentlich erstaunten und erfreuten Öffentlichkeit ein Befreiungsbuch vor. Und mitten in den maghrebinischen Befreiungsbewegungen vom Joch autokratischer Herrscher stammt dieses Buch auch noch aus dem Kopf einer jungen Frau, die in Marokko geboren wurde: Najat El Hachmi.
Mimoun wird von seiner Mutter vergöttert und von seinen Schwestern gehätschelt, denn Mimoun ist das Kleinod seiner Familie: Ein Sohn. Er hat immer wieder wohlinszenierte Wutanfälle, er schlägt gern, mit Vorliebe Frauen, und eigentlich ist er ein Blender. Aber wie alle wirklich guten Blender gelingt ihm die Blendung seiner Umgebung vorzüglich. „Für Mimoun“, den Mann, der in der marokkanischen Kabylei aufwächst, „waren Frauen … die ihre Ehre nicht bewahrten, nichts weiter als das: Höhlen in die man eindrang, um seinen Druck abzulassen.“ Mimoun wird der „Patriarch“ werden und seine Karriere beginnt früh.
Und was Ehre ist, das bestimmt er.
Es ist ein fulminantes Buch, das Najat El Hachmi geschrieben hat und es erzählt den Patriarchen, diesen „Elvis aus der marokkanischen Provinz“, mit einer nüchternen, distanzierten Sprache, die zuweilen, mitten in den brutalsten Situationen, mit einem leisen Augenzwinkern arbeitet. Zu vermuten ist, dass die gewählte Distanz den Schrecken, die Schmerzen lindern soll, jenes Leid, das die Autorin während des Schreibens empfunden haben muss, und auch das Mitleid, dass den Leser befällt, wenn er mit all den Tritten, den Fausthieben und der Verachtung vertraut gemacht wird, die fast alle Frauen in der Umgebung der unangenehmsten Romanfigur der letzten Jahre erfahren müssen. Es ist nur das seltene, aufflackernde Augenzwinkern, das Rettung verspricht: Lass ihn nur, das Arschloch von einem Schläger, sagt es, am Ende, verspricht der Text, am Ende sehen wir Mimoun am Boden, versprochen!
Gäbe es dieses Versprechen nicht, müsste man das Buch vor lauter Wut aus der Hand legen: Wenn Mimoun, der Arbeit wegen nach Spanien emigriert ist und jetzt die „Christinnen“ zu seiner Beute macht, möglichst geschieden und verunsichert, diese Huren, wenn er seine nächsten Opfer findet, wenn er seine „gezähmte“ Frau nachkommen lässt und wenn er beginnt seine Tochter auch zu zähmen. Denn „Töchter sind ihren Vätern treuer, sie hören mehr auf dich und lieben dich von ganzem Herzen.“ Was in der Übersetzung der Mimounschen Phrase nichts anderes heißt als: Sie haben Opfer seiner Gewalt zu sein, Dienerinnen seiner Bequemlichkeit und Vorzeigeobjekte seiner Macht.
Najat El Hachmi, die ihr Buch auf Katalanisch geschrieben hat, weiß wovon sie erzählt. Auch wenn ihre Romanfigur selbstständig und nicht das alter ego der Autorin sein dürfte, ist sie als Kind marokkanischer Einwanderer mit dem Milieu von Vater und Tochter eng vertraut. Und auf der Tochter des Patriarchen lastet alle Hoffnung. Sie wird sich über das Lesen und das Schreiben befreien. Sie wird uns Einblicke in die Sehweisen der Arbeitsemigranten geben und Sätze wie diesen, der auf der Reise in das fremde Spanien entstanden ist: „Vom Bus aus schienen die Menschen kleiner zu sein, wie sie so über die Gehwege neben jenen riesenhaften Zementblöcken eilten, ohne Furcht, diese könnten auf sie herunterstürzen“.
Die Tochter des „Letzten Patriarchen“ hat keinen Namen. Vielleicht, weil sie für viele Töchter stehen soll, Töchter, die ihren Aufstand, ihre Emanzipation noch vor sich haben. Ganz sicher sagt uns Najat El Hachmi, dass es die Frauen selbst sind, die sich befreien müssen, dass Befreiung nicht von außen kommen kann. Und ebenso sicher hat uns die junge Frau, die aus Marokko stammt und in Spanien aufgewachsen ist, ein sensationelles Buch geschenkt.
»Najat El Hachmis Humor und frische, unbekümmerte Sprache machen aus einem noch so schmerzhaften Thema einen wahren Lesegenuss.« (The Independent)Najat El Hachmi, 1979 in Marokko geboren und in Katalonien aufgewachsen, hat erstmals 2004 mit dem vieldiskutiertenEssay Jo també sóc catalana (Auch ich bin Katalanin) von sich reden gemacht. 2008 gewann sie mit Der letzte Patriarch überraschend den Premi Ramon Llull, den wichtigsten und höchstdotierten katalanischen Literaturpreis.Der Roman wurde bereits in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Lesung im DAI
Mittwoch, 23. März 2011 um 20:15 Uhr
Deutsch-Amerikanisches Institut – Sofienstraße 12 69115 Heidelber
Moderation und Lesung des deutschen Textes: Jakob Köllhofer
Eintritt: 8€/ erm. 5€/ Mitglieder 4€