Natur und Religion
Ob Naturkatastrophen als Strafe Gottes oder als Manifestation einer transzendenten Macht oder – nüchterner – als extreme Stressauslöser einherkommen: gleichgültig lassen Naturgewalten niemanden. Traditionell sind es die Hochreligionen, die das meiste Kapital aus traumatisierenden Erfahrungen schlagen.
Der britische Wissenschaftshistoriker Simon Winchester hat in seinem Buch „Der Tag, an dem die Welt zerbrach“ dargestellt, wie 1883 nach dem verheerenden Vulkanausbruch des Krakatau auf Indonesien, der Islam nach jahrhundertlangen vergeblichen Anläufen, sich endlich im Inselstaat durchsetzte: Indem er Erdbeben, Flutwellen und zigtausend Todesopfer als Strafe Allahs für die bis dahin ausgebliebene Bekehrung anpries und diese als einzigen Weg, eine Wiederholung zu vermeiden (der Widerruf nach dem Tsunami von 2004 lässt indes auf sich warten).
Dass diese Strategie keineswegs der Vergangenheit angehört, bezeugen die Verdammung der Aids-Kranken unisono durch katholische Kirche und Islam oder etwa die jüngsten Tiraden von amerikanischen und österreichischen Kanzeln gegen häretische Praktiken auf Haiti hinlänglich. Und nach dem 11. September konnten die christlichen Kirchen kaum ihre Genugtuung darüber verbergen, dass sich die Gotteshäuser wieder mit verstörten Probanten füllten.
Die europäische Aufklärung ist bekanntlich den umgekehrten Weg gegangen und hat sich unter dem Eindruck des Erdbebens von Lissabon, der 1755 die Stadt vollständig zerstörte, von den bis dato kursierenden Vorstellungen einer die Menschenschicksale zu ihrem Besten lenkenden Hand Gottes verabschiedet. Gerade noch hatte Leibniz die Vereinbarkeit des Allmächtigen mit dem Übel in der Welt aus einer prästabilierten Harmonie der „besten aller möglichen Welten“ abgeleitet – und dann wurde ausgerechnet ein Hauptquartier barocker Gottesfurcht auf so sinnlose Weise vernichtet. Seitdem war der Niedergang theologischer Beweisführungen nicht mehr aufzuhalten, aus sicherer Entfernung verlegte Immanuel Kant die Bewältigung des „schrecklich Erhabenen“ konsequenterweise in die Zuständigkeit des ästhetischen Subjekts.

"Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich". Wunderschön, diese Psalmen. Aber …
Nun spricht in der Tat vieles dafür, dass Religionen, deren Bevormundungen der Mensch nur deshalb erduldet, weil er zu träge ist, andere Rituale als das gute Schaf zur Stärkung seines geistigen Immunsystems zu ersinnen. Gelegenheiten und Anregungen zum Üben gäbe es indessen genug, wenn auch selten risikofrei zu handhaben. Wer beispielsweise am letzten Februarwochenende entgegen allen Warnungen von Experten und gesundem Menschenverstand sich in den Mischwald eines Mittelgebirges traute, der geriet unversehens in den Sog eines jener spektakulären Naturphänomene, wie sie in unseren gemäßigten Breiten künftig wohl häufiger vorkommen werden. Der Deutschen liebstes Naherholungsareal hatte sich, von Orkantief Xynthia ergriffen, in ein veritables Kriegsgebiet verwandelt, für das einem selbst so probate Ausdrücke wie Hexenkessel oder Tohuwabohu noch zu bildungsselig dünken. Turmhohe Bäume wurden von unsichtbaren Händen erfasst, geschüttelt, gebogen und verdreht, armdicke Äste losgerissen und durch die Luft geschleudert, wobei das ohrenbetäubende Getöse, das Knirschen, Ächzen und Krachen, Zischen, Tosen und Heulen ständig noch größeres Unheil anzukündigen schien. Alle Sinnes- und Geistesgegenwärtigkeit war gefragt, um nicht von einem der herumsausenden Bio-Trümmer erschlagen zu werden.
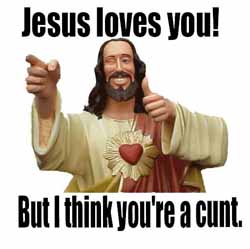
"Eine Kultur oder Gesellschaft ist dann 'traditionell', wenn sie sich nach Prinzipien ausrichtet, die nur menschliche und individuelle Ebene übersteigen, wenn jeder ihrer Bereiche von oben her und nach oben hin geformt und geordnet wird." (Julius Evola, Den Tiger reiten)
Übungen dieser Art gelten erst als abgeschlossen, wenn ihr Erfahrungsgehalt am Schreibtisch oder im Gespräch unter Freunden evaluiert wird. Dazu muss man nicht unbedingt Rudolf Ottos altrömisches Numen bemühen, um das mysterium tremendum et fascinosum zu beschwören, das sich diesmal in Gestalt eines Sturms offenbart hatte; schaden kann es allerdings nicht. Damals wie heute gilt die Maxime, dass man sich gelegentlich in Gefahr begeben muss, um den Wert des Lebens schätzen zu lernen – oder zumindest die Intensität eines nicht nur in ferner Zukunft, sondern jederzeit vom Abbruch bedrohten endlichen Daseins. Das metaphysische Bedürfnis, so die zweite Lehre des Exerzitiums, erschöpft sich keineswegs, wie vor allem Protestanten immer wieder betonen, im periodisch drängenden Bedarf nach Sinn und Orientierung; es umfasst darüber hinaus (unter anderem) auch die Sehnsucht nach ekstatischen, leidenschaftlichen, mystischen, kurz: nach echten Grenzerfahrungen.
Spaziergänge bei Windstärke 12 haben gegenüber gängigem Risikoverhalten (Raserei auf der Landstraße, Komasaufen, Fassadenklettern) den Vorzug, uns diese Grenzen und die Gefahren ihrer Überschreitung als Konfrontation mit einer ebenso anonymen wie absoluten Macht zu vergegenwärtigen, die wir für gewöhnlich nicht beachten, wenn sie uns unauffällig als „Wetter“ umgibt. Leider bietet das temperierte Klima Mitteleuropas noch viel zu selten Anlass, sich dem „anthropologischen Thrill“ (Sloterdijk) eines Elementarereignisses auszusetzen. Doch manchmal genügt es hierfür auch sich zu verlieben. Der emotionale Sturm, der den Zustand der Verliebtheit kennzeichnet, hält nicht nur vergleichsweise länger an; er beschert uns auch alle Hochs und Tiefs eines existenziellen Ernstfalls einschließlich des Unglück unerwiderter Gefühle und der Katastrophe einer gescheiterten Beziehung.
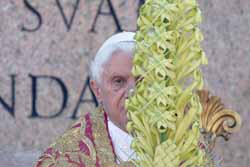
Dem derzeit durch "seine" Kirche fegenden Sturm wird er auch durch sich verstecken nicht entgehen können. Zu filigran-durchsichtig, das Alles …
Es versteht sich, dass monotheistische Religionen schon zur taktischen Ausschaltung einer unliebsamen Konkurrenz seit jeher versuchen, auch diese Form gesteigerten Lebensgefühls für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Und weil das sexuelle Verlangen, das den „religiösen“ Wahnzuständen der Liebe zugrunde liegt, sich als unbezähmbar erwies, musste seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt und reglementiert (Judentum, Islam) und seine Macht verteufelt werden (Christentum). Die mörderische Konsequenz, mit der besonders die katholische Kirche die Libido im Namen einer sadomasochistischen „Liebe zum Herrn“ bekämpft, verfolgt und bestraft hat, entwickelte dabei selbst Züge teuflischer Besessenheit.
Niemand hat diese unrühmliche Tradition genauer rekonstruiert als Karlheinz Deschner. Seine beeindruckenden Bestandsaufnahmen christlicher Sexualpathologien beschämen alle Versuche, diese als Ausnahmen zu bagatellisieren, wo sie doch den Regelfall darstellen. Und während wir uns weiter wundern, wie es vor allem dem Katholizismus möglich war, seinen selbstzerstörerischen Umgang mit den elementaren Kräften unseres Trieblebens noch bis ins 21. Jahrhundert zu verschleppen, blicken wir zuversichtlich dem Tag entgegen, da man in ähnlicher Breite und Schärfe über den Missbrauch metaphysischer Bedürfnisse durch die sogenannten Religionen diskutieren wird.