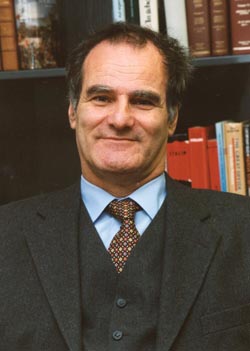Er blieb sich treu, aber er ließ sich auch täuschen: Heute vor hundert Jahren wurde der Religionsphilosoph Hans-Joachim Schoeps geboren.
Der Religionsphilosoph Hans-Joachim Schoeps, der am 8 Juli 1980 in Erlangen starb, wurde am 30. Januar 1909, also heute vor hundert Jahren, in Berlin geboren.
Sein ganzes Leben lang hatte er sich nie dem Zeitgeist gebeugt, sondern war stets seinem Gewissen – und seinem außergewöhnlichen Wissen – gefolgt. Einmal – als junger Akademiker – missverstand er die vorherrschende Denkweise jener Epoche, was ihm den Ruf eines „hitlertreuen“ Juden einbrachte.
Schoeps entstammte einer – damals nicht untypischen – national-deutschen jüdischen Familie; jahrhundertelang hatten seine Ahnen in deutschen, vornehmlich in preußischen, Landen gelebt. Sein Vater war Oberstabsarzt im Ersten Weltkrieg, überzeugter Patriot und Gegner sowohl der Sozialdemokratie als auch des Zionismus. Während seiner Studienzeit war der junge Schoeps Mitglied im „Freideutschen Werkbund“, einer national eingestellten Vereinigung innerhalb der Jugendbewegung. In diesen Jahren gehörte er auch zum Autorenkreis der von Hans Zehrer herausgegebenen Zeitschrift „Die Tat“. Er war ein eingefleischter Kritiker der liberalen Weimarer Republik und schrieb z.B. im April 1930 in jenem Blatt: „Der heute geforderte geschichtliche Widerstand gegen Kapitalismus, Bolschewismus und Amerikanismus (…) hängt ab vom Werden und Durchsetzen eines neuen Menschentypus …“ oder: „Es entstand die restlos entseelte, mechanisierte und verzwecklichte, unmenschlich gewordene Welt …“
Als mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 der Ausschluss der Juden aus dem öffentlichen Leben begann, gründete Schoeps zusammen mit einigen antizionistischen Freunden am 26. Februar 1933 den „Deutschen Vortrupp“. Diese Gruppe stimmte anfangs dem „epochalen Verdienst“ der NSDAP zu, Schoeps selbst schrieb im Oktober 1933: „Der durch und durch erkrankte Volkskörper konnte nur noch durch eine Radikalkur, durch eine Erneuerung der Säfte vom Zerfall bewahrt werden. Der Nationalsozialismus rettet Deutschland vor dem Untergang.“ Zur selben Zeit versuchte Schoeps den damaligen Reichs-Innenminister, Wilhelm Frick, davon zu überzeugen, dass der „Vortrupp“ wegen seiner „bündisch-nationalen Gesinnung“ und seiner Entschlossenheit, alle liberalistischen Formen in der jüdischen Gemeinschaft zu ändern, ein idealer Partner sei, um eine für beide Seiten tragbare Lösung des Judenproblems zu finden. Ein Gespräch aber kam nie zustande. Ergebnislos blieb auch im Frühjahr 1934 eine Zufallsunterhaltung mit dem – später ermordeten – SA-Stabschef Ernst Röhm.
Aus der heutigen Sicht und in Kenntnis dessen, was nachher geschah, besonders mit dem Wissen um den millionenfachen Mord an den europäischen Juden, ist das, was Schoeps und seine Getreuen 1933 und 1934 sagten, unverständlich.
Schon damals war es nur die Meinung einer Minderheit, und der Zionismus, der in Deutschland lange Jahre missachtet worden war, errang seine Prominenz. Daneben glaubte das Gros der deutschen Juden noch immer, es gäbe für sie in ihrem Heimatland auch unter dem Nationalsozialismus eine – wenn auch beschränkte – Lebensmöglichkeit. Das änderte sich erst nach dem sogenannten Nürnberger Reichstag vom Herbst 1935, der Juden das Staatsbürgerrecht raubte, und besonders nach den Herbstpogromen vom Jahr 1938. Aber selbst damals glaubte kaum einer an ein mögliches Genozid, weder unter den Juden, noch unter den – damals arisch genannten – anderen Deutschen.
Nach dem Krieg (1956) und nach Bekanntwerden der Gräuel trauerte Schoeps nicht nur um seine Eltern (der Vater starb in Theresienstadt und die Mutter wurde in Auschwitz ermordet), sondern bedauerte auch, dass er Tausende nicht aufgefordert habe, „auf Gedeih und Verderb“ zu fliehen, solange das noch möglich war.
Auf das Judentum war Schoeps erst während seiner Studienzeit aufmerksam geworden; er promovierte in Leipzig mit der Arbeit „Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie in der Neuzeit“. 1933 legte er das vorgeschriebene Staatsexamen für Lehramt in Deutsch, Geschichte und Philosophie ab, wurde aber nicht zum Referendardienst bestätigt als Jude.
Kurz vorher erschien sein erstes Buch „Jüdischer Glaube in dieser Zeit. Prolegomena (Vorbemerkungen) zur Grundlegung einer systematischen Theologie des Judentums“. Die Thesen dieses Buches wurden weitgehend abgelehnt. Besonders interessant ist die Besprechung des damals schon in Jerusalem lebenden Kabbalaforschers Gershom (zu jener Zeit noch Gerhard) Scholem, der dem Autor eine lutherische Beurteilung des Judentums vorwarf, und Schoeps‘ Antwort.
Ende 1938 konnte dieser nach Schweden entkommen. Er arbeitete an der Universität von Uppsala und forschte dort über die vorchristliche Essener-Gemeinde; diese Studien wurden später durch die Funde von Qmram am Toten Meer bestätigt. Nach dem Krieg kehrte Schoeps nach Deutschland zurück.
Er habilitierte sich in Marburg und wurde in Erlangen Professor für Religions- und Geistesgeschichte. Sein Habilitationsvortrag „Der Nihilismus als Phänomen der Religions- und Geistesgeschichte“ wurde typisch für Schoeps‘ weitere publizistische Werke.
Sie waren religiöse und geistesgeschichtliche Rückblicke, aber noch in stärkerem Maße Verbeugungen vor dem alten Preußentum und Bekenntnisse zur deutschen Vergangenheit.
Schoeps wurde auch damals von vielen missachtet, weil er schon kurz nach dem Krieg einen deutschen Patriotismus einforderte, der heute wieder selbstverständlich ist, in jenen Jahren aber verpönt war. Nie hatte er auch das Preußentum vergessen, obwohl es diesen Staat seit dem alliierten Kontrollratgesetz Nr. 46 am 25. Februar 1947 nicht mehr gab.
Die Idee des alten Reiches lebte in Schoeps fort und er sah seine Fortführung in einem geeinten Europa. Einen Festvortrag im Frühjahr 1968 beendete er mit der Hoffnung: „Wege vom Reich nach Europa.“ Er hatte den Zeitgeist vorausgeahnt.