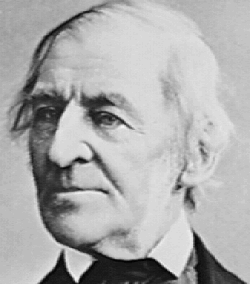Am 20. Januar wird der Machtwechsel in Washington vollzogen. Barack Obama weckt Gefühle und Erwartungen, die sich im Wahlkampf auch an dem Satz «Yes, we can» entzünden mochten. Ein anderer Satz, den Obama verwendet hat, bringt das amerikanische Lebensgefühl vielleicht noch besser zum Ausdruck: «Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.»
Aus den Reden, die Barack Obama auf seinem langen Weg ins Weisse Haus gehalten hat, sticht ein Satz heraus wie ein Gesicht aus einer Menge, das man nicht mehr vergisst. Dieser Satz fiel am 5. Februar 2008 in Chicago und lautete: «We are the ones we’ve been waiting for.» – «Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.»
Lässt man sich diesen wundersamen, wunderbaren Satz auf der Zunge zergehen, ist zu spüren: Er schmeckt nach Amerika. Und doch wird man erst einmal über diesen Satz stolpern. Man stelle sich vor, man träfe jemanden am Bahnhof, der stundenlang die Züge ein- und abfahren sieht und auf die Frage, was er denn hier mache, antwortet: «Ich warte auf mich selbst.» Darüber würde man den Kopf schütteln. Wie kommt es dann, dass jener Satz, den Obama sprach, nicht Kopfschütteln, sondern Jubelstürme bei seinen Zuhörern ausgelöst hat? Und warum fühlt man sich von ihm auf eigentümliche Weise ermutigt?
Guter Ton
Klar ist: Hier setzt jemand überschwänglich auf den Übergang von der Gegenwart zur Zukunft. Hier wird eine Stimmung verbreitet, in der der Knoten platzt, in der plötzlich möglich erscheint, was vorher undenkbar war. Die Rede vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten bekommt damit einen besonderen Sinn: Amerika ist nicht nur ein Land, das, wie George Washington einmal schrieb, über all die Güter, die fürs Leben «notwendig und angenehm» sind, im Überfluss verfügt. Amerika ist ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, weil es ins Werden verliebt ist, weil es sich auf die Zukunft stürzt wie andere auf Konfekt. Beim Weg in die Zukunft verlässt man sich nicht auf irgendeinen fertig ausgearbeiteten Plan, der umgesetzt wird, sondern auf die offene Haltung der Individuen: Sie sollen in Bewegung bleiben und bereit sein, im Spiegel ihr zukünftiges Ich willkommen zu heissen.
Der Gedanke, den Obama zum Ausdruck bringt, ist nicht ganz neu. Er gehört in den USA gewissermassen zum «guten Ton». Tatsächlich hat Obama den Satz «We are the ones we’ve been waiting for» auch gar nicht erfunden, sondern offenbar von der Dichterin June Jordan übernommen, die ihn um 1980 geprägt hat. Doch dieser Satz führt noch weiter zurück: in die Gründungszeit dieses Landes.
Benjamin Franklin
Knapp fünfzig Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung von 1776, zu deren Mitunterzeichnern er gehören sollte, gründete der junge Benjamin Franklin in Philadelphia einen Klub, dessen Vereinsziel darin bestand, «zur wechselseitigen Verbesserung» seiner Mitglieder beizutragen. Regelmässig sollten diejenigen gewürdigt werden – so stand es in der Satzung –, die «eine gute Tat vollbracht haben, welche Lob und Nachahmung verdient». So wie in diesem Klub, so sollte es nach Franklin auch draussen in der Welt zugehen. Sein Klub stand Modell für die USA, Franklin schwebte ein Land vor, das zwar nicht eine Besserungsanstalt, wohl aber eine gigantische Verbesserungsanstalt sein sollte.
Ralph Waldo Emerson
Wie Benjamin Franklin, so haben sich auch viele andere der wechselseitigen Verbesserung und der Selbstverbesserung verschrieben; keiner tat dies so wirkungsvoll wie Ralph Waldo Emerson, der Mitte des 19. Jahrhunderts den «amerikanischen Genius» zum Sprecher der «Partei der Zukunft» und zum Verächter der «Partei der Vergangenheit» erklärte. Bei Emerson gibt es Passagen, die geradewegs als Ouverture für Obamas Satz taugen. So entdeckte er bei seinen Landsleuten die «unersättliche Begierde», ihr altes Selbst zu «vergessen», von sich selbst «überrascht» zu werden, sich auf ein Leben einzulassen, in dem «keine Vergangenheit» mehr auf dem eigenen Rücken lastet. Verhasst waren Emerson all jene, die sich selbstgefällig gegenseitig auf die Schulter klopfen. Neben den Freunden, die uns trösten und stützen, schätzte er besonders jene, die uns harsch kritisieren und zurückweisen – und zwar deshalb, weil sie uns aus dem Status quo herausreissen und ein ganz «anderes Leben» vor Augen führen, das erst noch vor uns liegt. Dass Richard Ford in seine grossartigen Romane – zuletzt in «Die Lage des Landes» – hingebungsvoll Emerson-Zitate einstreut, ist nicht der schlechteste Beleg für dessen geistige Gegenwart. Fords spielerische Konfrontation zwischen der sogenannten «Permanenzperiode», in der sich das Leben im Kreise dreht, und dem «Next Level», zu dem man sich aufschwingt, taugt auch als Begleitmusik zu Obamas Erfolgsgeschichte.
Was von Emerson herübertönt, klingt in europäischen Ohren nicht völlig fremd. Vieles von dem, was Emerson schrieb, hinterliess kräftige Spuren im Werk Friedrich Nietzsches; und so ist es auch kein Wunder, dass dessen «Werde, der du bist» geradewegs als kürzeste Formel für die Zukunftsverliebtheit der Amerikaner gelten darf. Nicht nur wirkte Emerson auf Europa, er stand auch selbst unter dem Einfluss der europäischen Philosophie und der romantischen Schule. So klingt manches von dem, was Johann Gottfried Herder schrieb, plötzlich auch ein bisschen «amerikanisch»: «Wir (. . .) sind immer im Gange, unruhig, ungesättigt: Das Wesentliche unsers Lebens ist nie Genuss sondern immer Progression.»
Die amerikanische Verbesserungsanstalt ist uns Europäern nicht ganz fremd: Wir haben sie mit erfunden, sie hat auf uns abgefärbt. Und doch verwenden die Amerikaner bei ihrem Selbstporträt eine Palette mit einer ganz besonderen Mischung – in jeder Hinsicht, im Guten wie im Schlechten. Auch der Satz «Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben» schillert, wenn man ihn hin und her wendet, in den verschiedensten Farben.
Dieser Satz steht für den Willen, der Zukunft ein gutes Ende abzuluchsen; manche Amerikaner, die sich auf die Feier der Zukunft versteifen, meinen dann auch gleich die Vergangenheit mit Verachtung strafen zu müssen. Ein Beispiel dafür ist das berühmte Bonmot Henry Fords: «Geschichte ist Quatsch.» In der Tat trifft man in Amerika immer wieder auf Zukunftsfanatiker, die acht- und ahnungslos mit dem Erfahrungsraum des Vergangenen umgehen; sie neigen, kurz gesagt, zu einer gewissen Blödheit – und auf diese Blödheit trifft man dort in der grossen Politik ebenso wie bei manchen Handwerkern, für die der Ausdruck «Erfahrungsschatz» ein Fremdwort ist. Es ist nur ein Schritt von der Gestaltungskraft im Umgang mit der Zukunft zum Machbarkeitswahn. Auch er bricht in Amerika bekanntlich immer wieder – da in naiven, dort in gefährlichen Varianten – aus. Und doch lässt sich die amerikanische Lebensart nicht auf diesen Machbarkeitswahn reduzieren; immerhin kommt in dem Satz «Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben» auch eine gewisse Demut zum Ausdruck: Wer auf sich «wartet», muss sich in Geduld fassen können; er kann sich nicht nach Belieben als Selfmademan aus dem Hut zaubern. Natürlich gibt es Leute, die diese Nuance beiseitewischen und die Phantasie pflegen, Amerika bestehe überhaupt nur aus einer Ansammlung solcher Selfmademen; sie gehen mit kaltem Blick über diejenigen hinweg, die bei ihrer Selbstwerdung ins Stolpern kommen und vom Elend eingeholt werden. Und doch gehört zur «wechselseitigen Verbesserung» Benjamin Franklins auch die Hilfe in der Not. Manchmal muss man Amerika vor sich selbst in Schutz nehmen.
Eine der heikelsten Assoziationen, die Obamas Satz auslöst, führt von der Hoffnung auf eine gemeinsam gestaltete Zukunft zur Hoffnung auf den grossen Erlöser. Im Wahlkampf brach diese religiöse Eskalation immer wieder durch. Zwar setzte Obama selbst konsequent auf die Gemeinschaft, auf das «Wir»: «We are the ones», «Yes, we can» waren seine Parolen. Doch die Talkmasterin Oprah Winfrey konnte es nicht lassen, eine Wahlkampfveranstaltung in eine pseudoreligiöse Zeremonie zu verwandeln: «He is the one!», rief sie aus. Damit spielte sie auf eine Schlüsselszene aus dem Film «The Matrix» an, in der «Neo» jesusgleich von den Toten aufersteht und seine Anhänger daraufhin flüstern: «He is the one.» Dass Amerika ein erwähltes Land sein soll, dass die Präsidentschaft Züge eines Gottesgnadentums bekommt: Dies sind Momente einer Übersteigerung, in der die Begeisterung über die Zukunft in Heilserwartung umschlägt.
Bejahung der Demokratie
Zugegeben: Eine solche Übersteigerung liegt im Falle Obamas durchaus nahe, denn es hat in der ganzen Geschichte der Menschheit wahrscheinlich keinen Menschen gegeben, der unter derart schwierigen Bedingungen seine Arbeit aufnahm und auf den sich zugleich die Hoffnungen so vieler Menschen richteten. Ihn zum Heilsbringer hochzujubeln, ist aber auch deshalb gefährlich, weil man die Menschen damit von dem ablenkt, was wirklich getan werden kann und was sie selbst tun können.
Kurz sind die Wege von Obamas Satz vom Februar 2008 zu den Höhepunkten, aber auch zu den Abgründen, die auf der inneren Landkarte der amerikanischen Lebensart verzeichnet sind. Man muss es Obama hoch anrechnen, dass er selbst die Abgründe, die da gähnen, bisher gemieden hat. Lieber spielt er – ähnlich wie Thomas Jefferson und John F. Kennedy – den Ball zurück zu den Bürgern und reiht sich bei ihnen ein. Dass er dies tut, hat mit einer Lebenshaltung zu tun, die in Amerika eine Tradition hat wie in keinem anderen Land der Welt (wenn man von der Schweiz einmal absieht): der Bejahung der Demokratie.
Dieter Thomä lehrt Philosophie an der Universität St. Gallen und hat u. a. die Bücher «Unter Amerikanern. Eine Lebensart wird besichtigt» (C. H. Beck) und «Väter. Eine moderne Heldengeschichte» (Carl Hanser) veröffentlicht.
.