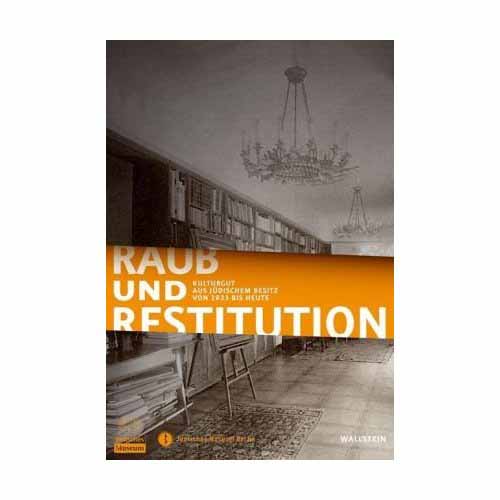Die Ausstellung "Raub und Restitution" im Jüdischen Museum Berlin: Ein tiefer Blick in den Abgrund …
Zehn Jahre nach der Unterzeichung der sogenannten Washingtoner Erklärung zur Rückgabe geraubten Kulturguts greift das Jüdische Museum Berlin das Thema „Raub und Restitution“ auf. Anhand von 15 Fällen wird nachgezeichnet, welchen Weg die Kulturgüter vom Raub bis zur späteren Rückübertragung genommen haben. Die Vizedirektorin des Museums, Cilly Kugelmann, betonte, mit der Ausstellung wolle man zeigen, wie „kompliziert diese Situation ist und dass gestohlenes Gut irgendwann zurückgegeben werden muss“.
Was ist übler als Mord? Das Morden aus Habgier. Und was noch ekelhafter? Wenn sich die Habgier mit Rassismus paart und so, ideologisch bemäntelt, den Profiteuren ein ruhiges Gewissen macht. Von dieser Art war die nazistische Beraubung der Juden. Ihr und dem oft peinigenden Nachspiel, in der Nachkriegszeit „Wiedergutmachung“ genannt, widmet sich eine Ausstellung des Jüdischen Museums Berlin. Die Schau „Raub und Restitution. Kulturgut aus jüdischem Besitz von 1933 bis heute“ lenkt den Blick in einen Abgrund aus Niedertracht.
Ideologische Verbrämung
Die als „Arisierung“ auftretende Plünderung jüdischer Vermögen, die nicht nur Bankkonten und Grundbesitz, sondern in einem wohl nie ganz zu erfassenden Umfang auch Kulturgüter betraf, bewirkte die gewaltigste Änderung von Besitzverhältnissen in Europas Geschichte seit der Säkularisierung der Kirchengüter. Bezeichnenderweise war die erfolgreichste braune Kunstraub-Organisation zugleich eine eminent ideologische: der Einsatzstab von Reichsleiter Alfred Rosenberg, dem Vordenker der NSDAP. „Dienstlich“, wie er vorgab, hatte es Rosenberg bei der Jagd nach fremdem Gut besonders auf wissenschaftliche Bibliotheken abgesehen. Beschlagnahmungen fanden umso ungenierter statt, als ihnen das Motiv zugeschrieben wurde, der „Erforschung der Judenfrage“ zu dienen.
.Die Rechtfertigungen für ihre Raubzüge mussten die Nazis manchmal gar nicht selbst erfinden. Sie konnten an alte antisemitische Stereotype oder bestehende bürgerliche Rechtsverordnungen anknüpfen, die sie nur noch zu verschärfen brauchten. Die Unterstellung beispielsweise, die Juden hätten ausschließlich ein pekuniäres, allenfalls funktionales Interesse an deutschen Kulturgütern und seien als Verwalter des nationalen Erbes ungeeignet, ergo müsse man ihnen die Kunstschätze aus der Hand nehmen, reicht bis in die Wilhelminische Zeit zurück. Und auch die «Reichsfluchtsteuer» wurde keineswegs von Adolf Hitler erfunden, sondern in der Weimarer Republik 1931 eingeführt und bis in die junge Bundesrepublik hinein beibehalten. Freilich besassen die demokratischen Regime nicht die Perfidie der Nazis, die den um Ausreise bemühten Emigranten formell „nur“ ein Viertel ihres Vermögens als Steuer abpressten, es de facto aber dahin brachten, dass Ausreisewillige nahezu alles verloren.
Gesetze und Fristen
Überlegungen, wie den Ausgeplünderten ihr Eigentum zurückerstattet werden könne, stellten die Alliierten, angeführt von den USA, schon vor Kriegsende an. Gleich nach der Niederlage Deutschlands gingen sie ans Werk, doch während es vergleichsweise leicht fiel, einstige Grundstückbesitzer zu identifizieren (die mittlerweile dezidiert von Restitution ausgeschlossen sind; in Heidelberg gibt es – Universität und Stadt -unerfreulich viele Beispiele dafür, dass „da kein Rankommen mehr“ ist), blieb die Restitution von Kulturgütern schwierig und beschäftigt die Beteiligten bis heute. Die Gesetze für eine Rückerstattung, wie sie die Alliierten schufen, sind überholt, und die Fristen, innerhalb welcher deren Berechtigte ihre Ansprüche anmelden konnten, sind abgelaufen. 1998 formulierte die „Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocausts“ Maximen für die Restitution. Eine rechtliche Verpflichtung indessen ergeht aus ihnen nicht.
Problematisch ist zudem, dass sich die Washingtoner Erklärung nur an Museen und vergleichbare Institutionen, nicht jedoch an private Sammler und den Kunstmarkt richtet. Rückgaben von Kulturgut an die Erben der einstigen jüdischen Eigentümer erfolgen oft zähneknirschend; die Anfeindungen, die in Deutschland die Restitution von Ernst Ludwig Kirchners Gemälde „Berliner Strassenszene“ auf sich zog, gaben für den Mangel an Unrechtsbewusstsein ein übles Beispiel. Man restituiert nolens volens, wenn sich Ansprüche nicht abwehren lassen – doch in einer Bringschuld, die es selbstverständlich einzulösen gilt, sieht sich der illegitime Besitzer von heute „nicht wirklich.
Die Ausstellung des Jüdischen Museums in Berlin ist von der Kirchner-Debatte motiviert, zeigt aber, dass „Raubkunst“ mehr meint als die im Fokus der Aufmerksamkeit stehenden Gemälde. Kulturgut jeder Art konnte Opfer des Raubs werden: Bücher, Handschriften, Porzellan- und Judaica-Sammlungen, Skulpturen, Münzen, silberne Kunstschmiedearbeiten, Mobiliar, Musikinstrumente. Für die Berliner Schau wurden 15 Fälle herausgegriffen, die jeweils exemplarische Natur besitzen: Der Raub etwa der reichen Kunstsammlung des Breslauer Anwalts Ismar Littmann erfuhr nachträglich eine ideologische Sanktion, indem daraus Akte des Expressionisten Otto Mueller genommen und zum Zwecke der Verfemung als „entartete Kunst“ gezeigt wurden. Der Fall Rothschild demonstriert, dass es den Nazis um Aneignung des Vermögens insgesamt ging. Die Bücher und Porzellane wiederum, welche die Familie von Klemperer bei ihrer Flucht aus Sachsen zurückliess, künden von der Politik der DDR, die – wie auch die Sowjetunion – eine Restitution von Raubkunst nie nötig fand.
Schlüssig-kluge Inszenierung
Die Berliner Schau bietet einige Objekte, die man als wahre Raubkunst-Zimelien bezeichnen kann, erstrangige Gemälde, kostbares Kunsthandwerk oder ein prachtvolles Virginal von 1633. Doch der Eindruck von Opulenz kommt nie auf; die Inszenierung verhindert konsequent eine kulinarische Rezeption. Bestimmendes Gestaltungsmittel sind Kisten aus Tischlerplatte, die, teils als Vitrinen, teils als Informationsträger, teils übereinandergestapelt, teils nebeneinandergestellt, die Ausstellung gliedern. Jede Fallgruppe beginnt mit einem zentralen Objekt (es werden nur Originale gezeigt), dessen Geschichte dann Dokumente berichten, die auf oder in den benachbarten Kisten angebracht sind. An den Wänden entlang läuft ein Band aus Text- und Fototafeln sowie Vitrinen. Dort findet der Besucher die Rahmenhandlung erzählt, die grosse politische Geschichte von Raub und Restitution, und dort findet er auch eine Foto aus dem Offenbacher Archival Depot, der Hauptsammelstelle der US-Behörden für geraubte jüdische Bibliotheken: Das Bild mit der tristen Halle, worin rohe Holzkisten stehen, überquellend von durcheinandergeworfenem Raubgut, liegt als eine Art Urbild dem Design der Berliner Schau zugrunde. tno
Verlängert bis zum 1. Februar 2009. Das ausgezeichnete, weit über das Material der Ausstellung hinausgehende Begleitbuch – mehr Monographie als Katalog – ist im Wallstein-Verlag erschienen. 328 S., € 24.80.
.