„Das Alter, eine einzige Heuchelei vor den Jüngeren“ – Martin Walser muß es ja wissen:
Geld und Liebe. Um diese beiden zentralen Themen kreist der Roman, der Roman eines fast Achtzigjährigen, der gleichwohl vor Ausdruckslust und -energie und -wut zu bersten scheint. Beides Lebensstoffe, die sich verflüssigen und verhärten, die zirkulieren und gestaut werden können, und da Martin Walser in all seinen vielen Büchern ein Meister ist, der unmittelbar „am Leben entlang“ schreibt, entbehrt auch diese späte Angstblüte in keinem Augenblick der Anschaulichkeit, die uns begreifen läßt, was auf dem Spiel steht.
„Angsttriebe“ nennt man das Phänomen, wenn eine Pflanze kurz vor dem Absterben noch einmal ausschlägt, und es ist wohl kein Zufall, wenn Martin Walser stattdessen das in der Botanikersprache nicht so geläufige Wort „Angstblüte“ als Romantitel wählt. Auch sein jüngster Held, Karl von Kahn, schlägt kurz vor dem Absterben noch einmal aus, aber Kahn ist, wenn es um seine Triebe geht, „verblümt bis ins Innerste und Äußerste“. daß diesem rundum Blumigen nicht nur die Unverblümten in der Kampfzone draußen Probleme machen, sondern auch sein Zartheitsgebot im eigenen Kopf, liegt in der Natur der Walserschen Helden
Karl von Kahn, der siebzigjährige Protagonist, ist also Finanzdienstleister von Beruf. Nicht Fahrdienstleiter, wie der Ennepetaler Onkel einer Geliebten – das sind auf den Bahnhöfen die mit den roten Mützen, die Jakobiner des deutschen Beamtentums -, sondern Finanzdienstleister, Anlageberater, Geldvermehrer: einer der prototypischen Berufe der Jetztzeit. Geld ist ein magisches Element. Es läßt sich, lernen wir, mit etwas Geschick fast beliebig vermehren. Das funktioniert ungefähr so wie die wunderbare Brotvermehrung in der Bibel: Man weiß nicht wie; aber es funktioniert. Im Idealfall ist die Geldvermehrung reiner Selbstzweck. Anderen ist die Tätigkeit, mit der sie Geld verdienen, wichtiger als das Geld, das sie verdienen: „Ihm“, heißt es über den Romanhelden, „war von Anfang an das Geld wichtiger als die Tätigkeit, mit der er es verdiente“.
Sehnsuchtsdilemma
Moral gehört nicht zu den zentralen stofflichen Elementen des Romans, jedenfalls nicht in der landläufigen Form. Karl von Kahn ist ein Instinktmensch auf der Suche nach Glück; mehr als alle Studienräte und Chauffeure, all die in Abhängigkeiten Eingezwängten der mittleren Epoche im Schaffen Walsers ist dieser Münchener Geldmensch ein weiterentwickelter Anselm Kristlein, der Held der Sechziger-Jahre-Trilogie: einer, dem Unabhängigkeit als der größte Wert gilt, zugleich ein erotisch Getriebener, ein rastloser Liebhaber.
Doch dazu gesellt sich, altersbedingt, ein sympathisches Fünkchen Torheit. Karls Ehefrau Helen (für beide ist es die zweite Ehe), Ehetherapeutin, ist mit ihren herrlich keuschen Mahlzeiten von Avocado bis Zucchini der unentbehrliche Ankerplatz in der Schwabinger Osterwaldstraße; aber der Mann begehrt Fleisch, keineswegs das Hähnchenfleisch vom Imbiss, wie Helen mutmaßt, sondern das Fleisch junger Frauen: Was aus dieser Notlage folgt, und das müssen wir ihm und seinem Autor nun einfach glauben, heißt nicht Sex, sondern Liebe.
Natürlich läßt Liebe sich nicht kaufen, das weiß Karl von Kahn auch, aber sie ist doch auch Funktion eines komplexen Handels. Wenn von Kahn ohne weiteres zwei Millionen bereitstellt, um an eine junge Schauspielerin heranzukommen, ist er sich der ins Auge springenden Anrüchigkeit dieses Deals kaum bewußt: naiv oder charmant, wie immer man will – wird sie ausgeblendet.
Er kauft nicht den Körper einer Frau – er verliebt sich in sie. Die romantische Komponente rettet den Roman vor jeder zynischen Zuspitzung à la Houllebecq (der allerdings dem starken Ansturm des Romantischen durch die Hintertür durchaus Einlass verschafft). Unser Held hat das Geld, das der Filmregisseur Theodor Strabanzer – einer der Walser-typischen, letztlich stets erfolgreichen Schwätzer und Angeber – benötigt, um sein „Othello-Projekt“ zu verwirklichen: Also gibt er es ihm. Joni Jetter, die Schauspielerin, ist der Köder, und keine Frage, daß es dieses Köders bedarf, um die Filmgeschichte voranzubringen. Schon am nächsten Abend liegen Karl und Joni in der Kronprinzensuite zu Herrsching am Ammersee zusammen im Bett.
Nun läuft das ganze Programm ab, einschließlich der so absurd unangebrachten Eifersuchts-Anfälle, der insistierenden Fragen nach der sexuellen Vorgeschichte, mit denen der Siebzigjährige die Dreißigjährige torpediert. Unangebracht nach Maßgabe eines herkömmlichen Deals – aber Karl von Kahn ist ja ein Liebender, und für Liebende gibt es keine Übertreibungen. Noch nie hat einer so geliebt wie Karl von Kahn diese Joni Jetter. In der Differenz zwischen dieser üppigen Ausstattung mit Gefühlsaufwand und der prosaischen Geschäftsgrundlage der Begegnung liegt der Witz. Man könnte, mit einer schönen Walserschen Wendung, auch sagen: die Verblümung. Freund Diego, der Antiquitätenhändler, steuert seine Ziele immer direkt an. „Diese Unverblümtheit kam an als Notwendigkeit. Karl war alles andere als unverblümt. Er war verblümt. Verblümt bis ins Innerste und Äußerste.“
Barocker Gegenwartsdichter
Logisch: Er wäre sonst ja kein Walser-Held. Dessen erstes Kennzeichen ist nun einmal die Verblümtheit. Also die Ausschmückung, die Camouflage, die verdeckte Operation und als erzählerische Strategie die Ironie. Aber die Notwendigkeit treibt Karl von Kahn ebenso an wie Freund Diego. Natürlich hat er Angst. Aber die Angst, das ist sein Glück, lähmt ihn nicht. „Angst ist der Grund für alles. Angst macht dich empfindlich. Deine Angst blüht auf in dir, hat einen Duft, den spürst du als Droge.“
Zur Verblümung gehört auch der Überfluß. Notwendigkeit und Überfluß schließen sich nicht aus, sondern lassen sich in einer paradoxen Formel sogar ineins setzen: Le superflu, chose très nécessaire – das Überflüssige ist das Notwendige, diesen Satz hat Karl bei Voltaire entdeckt. Darin findet er seine Lebensstimmung ausgedrückt. Wenn Karl und seine Geliebte bei einem Ausflug nach Andechs die Klosterkirche betreten und den Ausstattungsüberfluss dieses Sakralbaus auf sich wirken lassen, wird einem wieder bewußt, daß ja auch unser Martin Walser ein Barockdichter ist, der Barockdichter der Gegenwart. Ein Lakoniker war dieser Autor noch nie, auch nicht in jener vorübergegangenen Phase, als seine Sätze immer kürzer wurden. Redundanz ist ihm überhaupt kein Makel, Sparsamkeit ein Fremdwort. Von der Großzügigkeit seines Autors profitiert der Held. Geld, das sich vermehren lässt, muss man nicht sparen. Gefühle, die das Nerven- und Hormonsystem produzieren, soll man nicht unterdrücken, sondern verausgaben; sich nicht verbieten, sondern einbringen in den Kreislauf des Lebens. Selbst dann, wenn es töricht erscheint.
Eines macht dieser Altersroman wieder einmal unmißverständlich klar: Die Notwendigkeit (oder Lust), sich an diesem Kreislauf zu beteiligen, läßt mit dem Alter kaum mehr als gar nicht nach. Keine Beruhigung der Nerven, keine nennenswerte Milderung des Triebs in Sicht. Mag man sich noch so sehr über sinnlose Wörter wie „das Geschlechtsteil“ mokieren – „Ein Wort, als wäre es bei einer Aufsichtsratssitzung entstanden“ -, die faktische Evidenz des Signifikats lässt sich nicht leugnen. Freundschaften – wie die mit Diego – verblassen, zeigen Abnutzungserscheinungen; die sexuelle Antriebskraft, die erotischen Phantasien treiben nach wie vor die erstaunlichsten Blüten. Appelle an die Sterbebereitschaft zwecklos. „Er ist alt, das stimmt. Aber er hat keine anderen Wünsche und Absichten als jemand, der zwanzig Jahre jünger ist. Der einzige Unterschied: Er muss so tun, als habe er diese Wünsche und Absichten nicht. Als sei er darüber hinaus. Deshalb ist das Alter eine Heuchelei vor den Jüngeren.“
Helen ist die Frau, die Karl von Kahn offenbar liebt. Das weiß er. Und das genügt ihm nicht. Als Anlageberater und Eheberaterin ergänzen sie sich perfekt: Beide operieren an den zentralen neuralgischen Punkten des sozialen Nervensystems. Geld und Liebe, wie gesagt. Helen kämpft um den Fortbestand jeder Ehe, als hinge das Heil der Menschheit davon ab. Um ihre eigene Ehe kämpft sie am Ende nicht mehr. Sie kapituliert, als sie einsieht, daß ihre Hoffnung, der Mann im Mann werde eines Tages doch zur Besinnung kommen, schon immer getrogen hat.
Formulierungsfest
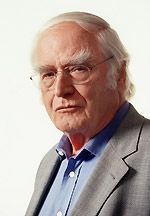 Martin Walser beherrscht die Kunst, uns seine Figuren allein durch die Skizzierung ihrer Lippenpartie vor Augen zu stellen, er ist ein Beobachtungsvirtuose, dessen Erfassung persönlicher Eigenarten sich in den schönsten Kompositionen niederschlägt. Sonderlich das verbale Nachturnen mimischer Macken ist schwer überbietbar. In dieser Hinsicht ist diese Milieustudie ein Formulierungsfest, radikal komisch, nuancenverliebt, metaphernbesessen. Daß sich Karl von jener „Kulturfraktion“ unterscheidet, der sowohl seine zweite Gattin als auch sein bester Exfreund anhängen, will man freilich so recht nicht glauben: Walsers Figuren sind, wie es über den Medienmogul und „Millionensassa“ Amadeus Stengl heißt, allesamt „glanzvolle Formulierer“. Jeder Satz gerät ihnen zur Pointe, jede Nebenbemerkung zu einem rhetorischen Coup. Daß die Reden sich insofern gleichen, nimmt man auch deshalb gerne in Kauf, weil jeder Tonwechsel die Koloraturen dieses Gesangs empfindlich stört.
Martin Walser beherrscht die Kunst, uns seine Figuren allein durch die Skizzierung ihrer Lippenpartie vor Augen zu stellen, er ist ein Beobachtungsvirtuose, dessen Erfassung persönlicher Eigenarten sich in den schönsten Kompositionen niederschlägt. Sonderlich das verbale Nachturnen mimischer Macken ist schwer überbietbar. In dieser Hinsicht ist diese Milieustudie ein Formulierungsfest, radikal komisch, nuancenverliebt, metaphernbesessen. Daß sich Karl von jener „Kulturfraktion“ unterscheidet, der sowohl seine zweite Gattin als auch sein bester Exfreund anhängen, will man freilich so recht nicht glauben: Walsers Figuren sind, wie es über den Medienmogul und „Millionensassa“ Amadeus Stengl heißt, allesamt „glanzvolle Formulierer“. Jeder Satz gerät ihnen zur Pointe, jede Nebenbemerkung zu einem rhetorischen Coup. Daß die Reden sich insofern gleichen, nimmt man auch deshalb gerne in Kauf, weil jeder Tonwechsel die Koloraturen dieses Gesangs empfindlich stört.
Eine solche Tonstörung produziert die Schauspielschülerin Joni Jetter, deren „unverblümter“ Porno-Jargon beinah so schauderhaft ist wie ihre Lyrik. daß Karl von Kahn auf diese nichts als blonde Nebendarstellerin mit seinem Motto „Bergauf beschleunigen“ antworten muß, bringt das Buch auf die lange Strecke von 477 Seiten dann doch ein wenig ins Keuchen. Karls Liebestraum will sich den knappen Ressourcen des Alters nicht beugen. So ist die Angst: Sie treibt Blüten gegen das Aufhören; der Roman leidet am Ende an einem Mangel an literarischer Ökonomie. Gleichwohl steht unterm Strich eine positive Bilanz: 300 Seiten reines Lesevergnügen. Der Rest ist Investition.
Martin Walser: Angstblüte. Roman.
Rowohlt Verlag, Reinbek, 477 Seiten, 22,90 Euro.