Plädoyer für den richtigen Umgang mit Büchern. Auf einen solchen Freifahrschein wartete man als Kritiker: Der bestqualifizierte Rezensent seines Buches, sagt da ein Autor im Interview, sei natürlich der, der sein Buch nicht gelesen, sondern bestenfalls von ihm gehört habe …
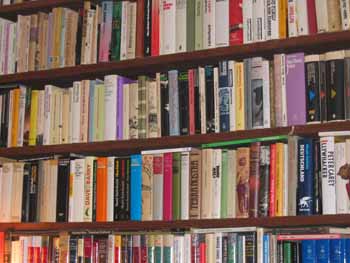 Der Autor heißt Pierre Bayard, ist Literatur- wissenschafter an der Université de Paris VIII, und sein – sehr erfolgreiches – Buch trägt den für einen Mann seines Standes unverschämten Titel: «Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?» («Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat»). Es geht darum, wie der normalsterbliche Leser, der nicht seit Jahr und Tag mit Kants drei «Kritiken», Platons Dialogen oder einfach nur Stifters «Nachsommer» auf dem Nachttisch zu Bett geht (die «Krone von Polen» versprach schon damals Hebbel dem, der – ohne als Rezensent dazu verpflichtet zu sein – den «Nachsommer» bis zur letzten Seite lese) – wie also wir alle, die wir so vieles nicht gelesen haben, was im deutschsprachigen Abendland als unverzichtbarer Bestandteil von «Bildung» gilt und in Frankreich «culture» wäre, trotzdem mitreden können und dürfen.
Der Autor heißt Pierre Bayard, ist Literatur- wissenschafter an der Université de Paris VIII, und sein – sehr erfolgreiches – Buch trägt den für einen Mann seines Standes unverschämten Titel: «Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?» («Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat»). Es geht darum, wie der normalsterbliche Leser, der nicht seit Jahr und Tag mit Kants drei «Kritiken», Platons Dialogen oder einfach nur Stifters «Nachsommer» auf dem Nachttisch zu Bett geht (die «Krone von Polen» versprach schon damals Hebbel dem, der – ohne als Rezensent dazu verpflichtet zu sein – den «Nachsommer» bis zur letzten Seite lese) – wie also wir alle, die wir so vieles nicht gelesen haben, was im deutschsprachigen Abendland als unverzichtbarer Bestandteil von «Bildung» gilt und in Frankreich «culture» wäre, trotzdem mitreden können und dürfen.
Und wer, «scheinheiliger Leser – meinesgleichen – mein Bruder!» (Baudelaire), hätte, Hand aufs Herz, sich selbst nicht schon einmal dabei erwischt, mitgeredet zu haben, wenn es um Bücher ging, die er nicht wirklich gelesen hat – in der Prüfung, unter Freunden, beim mondänen Abendessen? Da wir bei den Geständnissen sind, gestehe ich freilich, in naiver Anwendung der berufsethischen Praktiken (zumindest das Buch, das man bespricht, sollte man gelesen haben), daß ich Pierre Bayards Buch von vorne bis hinten gelesen und sogar, in meinem persönlichen Exemplar, ausführlichst annotiert habe. Die oben zitierte Freistellung von der Lektüre kam zu spät.
Balzac, Eco, Musil
Als adäquater Rezensent wären wir somit disqualifiziert. Doch es bleibt die – vielleicht rettende – Möglichkeit, zunächst über ein Buch zu sprechen, das wir tatsächlich nicht gelesen, sondern von dem wir – dank Bayard – nur gehört haben. Bayard selbst hat übrigens manches Buch gelesen (wie hätte er es sonst, so die ängstliche Frage, zum Professor bringen können?), allerdings vorzugsweise solche, in denen (bei Balzac, bei Eco, bei Musil) Menschen über Bücher reden, die sie nicht gelesen haben. Nehmen wir also David Lodges Roman «Ortswechsel». Dort ist die Rede von einem Gesellschaftsspiel unter jungen amerikanischen Intellektuellen, bei dem gewinnt, wer den anderen Teilnehmern glaubhaft versichern kann, ein berühmtes Werk der Weltliteratur nicht gelesen zu haben.
Einer der Mitspieler, Howard Ringbaum, hat nun ein doppeltes Problem: Er will, bei jedem Spiel, um jeden Preis gewinnen. Und er will, um keinen Preis, für ungebildet gelten. Dergestalt zwischen Skylla und Charybdis hin und her gerissen, gibt er, der junge und ehrgeizige Literaturdozent, irgendwann zu, «Hamlet» nicht gelesen zu haben – und verliert gleich zweimal: Niemand glaubt ihm, und kurz darauf wird ihm, aufgrund des öffentlichen Bekenntnisses, die ersehnte Festanstellung an der Universität versagt. Dabei ist der begabte Ringbaum, der besagtes Theaterstück nur aus der Verfilmung mit Lawrence Olivier kennt, aber so einiges über und von Shakespeare gelesen hat, durchaus in der Lage, einigermassen kompetent über «Hamlet» zu reden. Zumindest so kompetent wie der reale Bayard, der vor seinen Studenten auf James Joyces «Ulysses» zu sprechen kommen kann, ohne sich mit dem Roman jemals eingehender beschäftigt zu haben.
So provokant Titel und zuweilen Argumentation von Bayards Essay klingen mögen, so intelligent und amüsant ist seine Apologie des Nicht-Lesers. In Zeiten, da allenthalben wieder der Begriff der altbackenen «Bildung» Konjunktur hat, sind die polemischen Einwürfe Bayards nicht nur erfrischend, sondern auch willkommen. Denn, so lautet seine eigentliche Frage, was heißt überhaupt Lesen? Angesichts der unüberschaubaren Masse des Geschriebenen sind wir – so Bayard – alle, auch die «professionellen» Statthalter der Kultur, tendenziell Nicht-Leser. Auch der gefräßigste Bücherwurm nagt in der ihm beschiedenen Lebenszeit immer nur eine kleine Ecke in der großen Bibliothek der Weltliteratur an. Ja, er müsste schon an Raymond Queneaus «Hunderttausend Milliarden Gedichten» (1960) scheitern, jenem vergleichsweise schmalen Werk, das, bringt man die ihm zugrundeliegende Kombinatorik zur Anwendung, potentiell 10 hoch 14 Sonette enthält. Beunruhigender noch: Selbst wenn wir die «Suche nach der verlorenen Zeit» dreimal, den «Mann ohne Eigenschaften» zweimal gelesen haben – was bleibt davon nach zehn Jahren? Lesen heißt eben auch augenblickliches und fortschreitendes Vergessen.
Valéry und Proust
Und so geht es Bayard eben nicht darum, was wir abfragbar von einem Buch oder einem Autor wissen (müssen), sondern darum, was wir als Leser, oder als flüchtiger Nicht-Leser, aus einem Buch machen. Anders: Das Buch, das wir (noch) nicht gelesen haben, ist nicht zuvörderst das Buch, das bereits irgendwo existiert, sondern eher ein virtuelles Buch, das erst entsteht, indem wir – und sei es noch so kursorisch – lesen. Ein Paradoxon? Nicht unbedingt: Wer nur drei Seiten Dostojewski gelesen hat, kann zwar nicht von sich behaupten, ein Dostojewski-Kenner im Sinne der Philologie zu sein, doch können schon diese drei Seiten genügen, dem Leser das «Virus» Dostojewski einzupflanzen, so daß sich ihm fortan – eine Erfahrung, die jeder wirklich glückliche Leser irgendwann mit irgendeinem Buch gemacht hat – die Welt, die eigene Welt, in einem völlig neuen Licht darbietet. Paul Valéry, einer von Bayards Kronzeugen, brachte so das Kunststück fertig, 1923 in einem kleinen Artikel höchst eloquent über Proust zu reden, ohne ihn wirklich gelesen zu haben. Und Proust selbst hielt das Lesen, sofern es nicht zu eigener Produktion führte – zu Produktion und Entzifferung des «livre intérieur», das wir alle in uns tragen –, für eine rein «passive», sterile («livresque») und also sinnlose Tätigkeit.
Wir müssen lernen, sagt der Professor und Psychoanalytiker Pierre Bayard, was selbstverständlich sein sollte: selbstbewußt mit der Welt der Ideen und der Bücher umzugehen. Der Leser hat das Recht (und laut Bayard fast schon die Pflicht), den Büchern gegenüber seinen Eigensinn zu behaupten, diese gegebenenfalls nur als Steinbrüche zu besichtigen und, oder auszubeuten. Denn im Zweifel gilt auch hier Kants Maxime, man habe sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Pierre Bayards Essay belebt auf erfrischend unorthodoxe Weise die Diskussion darüber, wie insbesondere in unseren Lehranstalten mit Literatur umgegangen wird – oder in Zukunft umgegangen werden soll. In der Zwischenzeit mag ein Satz von Oscar Wilde weiterhelfen: «Ich lese nie die Bücher, die ich zu besprechen habe. Man läßt sich allzu leicht von ihnen beeinflussen.»
Jürgen Gottschling
Pierre Bayard: Comment parler des livres que l’on n’a pas lus? Editions de Minuit, Paris 2006. got