Bitte, wer mag denn wirklich glauben wollen, daß das Leben über den Tod siegte. Ist dieser doch schließlich in der Tat die Antwort auf: „… und erlöse uns von dem Übel.“ – Aber was ist dann mit der „Auferstehung jenes Toten“?
Da geht es also am Ostersonntag um die Geschichte eines leeren Grabes. Wir wollen ja nun wirklich niemandem die Freude verderben über diesen Feier-Tag mit schönem Wetter, einem Osterspaziergang (siehe), aber es muß mitgeteilt werden dürfen, daß DER, von dem am Ende des Tages oft gesagt worden sein wird, er sei „auferstanden von den Toten“ – und deshalb sei, (was Wunder) natürlich auch sein Grab leer gewesen, das das Wunder nicht gewesen sein kann:
 Denn, diese Geschichte erzählt keine wirkliche Wirklichkeit: Sobald wir anfangen, von möglichen leeren Gräbern der Römerzeit, sei es auf dem „Heiligen Friedhof“ oder außerhalb der Stadtmauern, an der Damaskus-Straße, in der Nähe der École Biblique, zu sprechen zu kommen, befinden wir uns in der Tat „nicht in dieser Welt“, nicht mehr in jener Welt, in der die Evangelien das leere Grab angesiedelt haben. Das Grab ist leer, weil es nicht existierte. Die Unmöglichkeit der Auferstehung ist ein wesentlicher Teil der Geschichte – seit Ba’al auf die Tränen seiner Schwester und seines Volkes antwortete und zusammen mit dem neuen Frühjahrsweizen aus der Unterwelt zurückkehrte. Die Geschichte vom leeren Grab ist eine jüdische Variante des ersten Jahrhunderts in einer langen Kette von Traditionen, innerhalb derer die Autoren der Evangelien sehr bewußt ihre Geschichten geschaffen haben, in dem sie über die Auferstehungsgeschichten von Elia und Elisa im Buch der Könige hinausgingen. Es geht uns hier, bitte g l a u b e n (sic) Sie uns das, darum, klar zu machen, daß die Evangelien nicht in einer wie auch immer rekonstruierten historischen Wirklichkeit des ersten Jahrhunderts spielen. Sie und mit ihnen das leere Grab sind Teil einer fiktiven Geschichte, in der das alte Thema des Sieges des Lebens über den Tod zu einem beeindruckenden vorläufigen Abschluß gebracht wird, wenn Jesus – wie Elia vor ihm – vom Himmel aufgenommen wird, so daß eine neue Generation ihre Geschichte wieder von Neuem beginnen kann. Der Jesus, den wir aus den Evangelien kennen, der Jesus, der am Kreuz starb und von dem es das leere Grab gibt, ist ein Jesus, den die Autoren der Evangelien – die erzählerischen jüdischen Traditionen verarbeitend – uns geschenkt haben.
Denn, diese Geschichte erzählt keine wirkliche Wirklichkeit: Sobald wir anfangen, von möglichen leeren Gräbern der Römerzeit, sei es auf dem „Heiligen Friedhof“ oder außerhalb der Stadtmauern, an der Damaskus-Straße, in der Nähe der École Biblique, zu sprechen zu kommen, befinden wir uns in der Tat „nicht in dieser Welt“, nicht mehr in jener Welt, in der die Evangelien das leere Grab angesiedelt haben. Das Grab ist leer, weil es nicht existierte. Die Unmöglichkeit der Auferstehung ist ein wesentlicher Teil der Geschichte – seit Ba’al auf die Tränen seiner Schwester und seines Volkes antwortete und zusammen mit dem neuen Frühjahrsweizen aus der Unterwelt zurückkehrte. Die Geschichte vom leeren Grab ist eine jüdische Variante des ersten Jahrhunderts in einer langen Kette von Traditionen, innerhalb derer die Autoren der Evangelien sehr bewußt ihre Geschichten geschaffen haben, in dem sie über die Auferstehungsgeschichten von Elia und Elisa im Buch der Könige hinausgingen. Es geht uns hier, bitte g l a u b e n (sic) Sie uns das, darum, klar zu machen, daß die Evangelien nicht in einer wie auch immer rekonstruierten historischen Wirklichkeit des ersten Jahrhunderts spielen. Sie und mit ihnen das leere Grab sind Teil einer fiktiven Geschichte, in der das alte Thema des Sieges des Lebens über den Tod zu einem beeindruckenden vorläufigen Abschluß gebracht wird, wenn Jesus – wie Elia vor ihm – vom Himmel aufgenommen wird, so daß eine neue Generation ihre Geschichte wieder von Neuem beginnen kann. Der Jesus, den wir aus den Evangelien kennen, der Jesus, der am Kreuz starb und von dem es das leere Grab gibt, ist ein Jesus, den die Autoren der Evangelien – die erzählerischen jüdischen Traditionen verarbeitend – uns geschenkt haben.
 Und wenn die Evangelien zum Beispiel Jesus auf dem Ölberg zeigen, wie er sich auf seine Verhaftung und Hinrichtung vorbereitet, dann wird hier eine kleine Geschichte aus der Daviderzählung variiert. David hat seinen Thron, seine Armee – von einigen wenigen Freunden abgesehen -, er hat einfach alles verloren. Absalom, sein Sohn, jagt ihn. David steigt in dieser Situation zusammen mit seinem treuen Freud, dem Priester Zadok (ein wahrlich sprechender Name: Zadok heißt „der Gerechte“), auf den Ölberg, „die Höhe, wo man Gott anzubeten pflegte“. Es ist eine Szene der Erniedrigung, ein sehr gefühlsbetonter Augenblick der Davidgeschichte. David und seine Freunde sind barfuß, sie senken die Köpfe und weinen. In dieser Szene erklärt David: „Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, daß ich die Bundeslade und ihre Stätte wiedersehe. Spricht er aber: Ich habe kein Wohlgefallen an dir – siehe, hier bin ich. Er mach’s mit mir, wie es ihm wohlgefällt.“ (1. Samuel 15,25-26) Von diesem Augenblick an wendet sich Davids Geschichte, und er gewinnt sein Königreich wieder.
Und wenn die Evangelien zum Beispiel Jesus auf dem Ölberg zeigen, wie er sich auf seine Verhaftung und Hinrichtung vorbereitet, dann wird hier eine kleine Geschichte aus der Daviderzählung variiert. David hat seinen Thron, seine Armee – von einigen wenigen Freunden abgesehen -, er hat einfach alles verloren. Absalom, sein Sohn, jagt ihn. David steigt in dieser Situation zusammen mit seinem treuen Freud, dem Priester Zadok (ein wahrlich sprechender Name: Zadok heißt „der Gerechte“), auf den Ölberg, „die Höhe, wo man Gott anzubeten pflegte“. Es ist eine Szene der Erniedrigung, ein sehr gefühlsbetonter Augenblick der Davidgeschichte. David und seine Freunde sind barfuß, sie senken die Köpfe und weinen. In dieser Szene erklärt David: „Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, daß ich die Bundeslade und ihre Stätte wiedersehe. Spricht er aber: Ich habe kein Wohlgefallen an dir – siehe, hier bin ich. Er mach’s mit mir, wie es ihm wohlgefällt.“ (1. Samuel 15,25-26) Von diesem Augenblick an wendet sich Davids Geschichte, und er gewinnt sein Königreich wieder.
Und um genau eben eine solche Geschichte von Selbst-Erkenntnis und Demut geht es auch den Autoren der Evangelien, wenn sie Jesus verzweifelt betend im Garten Gethsemane zeigen. Seine demütige Selbstverleugnung kulminiert in dem Satz: „Doch nicht, was ich, sondern was Du willst, geschehe“. Die Szene soll klarmachen, daß Jesus mit seinem Leiden und mit seinem Tod in sein Königreich eingehen wird, wie David es tat. Das hat ehrwürdige Tradition: Die Rolle von Gottessöhnen verlangt den absoluten Gehorsam gegenüber dem absoluten jüdischen Gott.
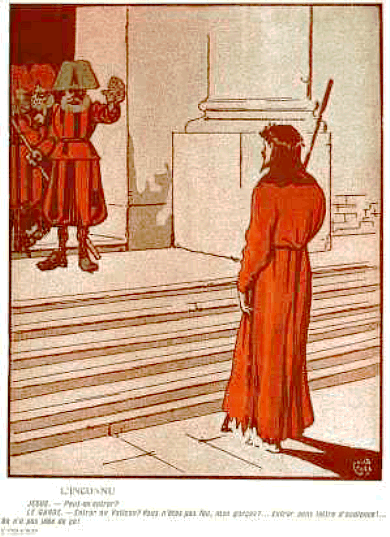 Wie könnte es anders sein, als daß Fragen nach einem historischen Jesus fehl gehen. Vielmehr geht es darum, das Christentum zu legitimisieren als irgendetwas Relevantes über das zu sagen, was die Bibel meinte. (Jesus schafft es in den Tempel hineinzukommen und schmeißt die Geldwechsler raus; was tät er heute wohl mit Ratzinger, Benedikt und der „Banco Spirito di Sancto“?) Ob es jemals einen historischen Jesus gab, wissen wir definitiv nicht. Wir wissen aber: Die Evangelien sind an einem solchen Jesus nicht interessiert. Wirklich alles, was wir heute über Jesus wissen, stammt aus Allegorien, aus fiktiven Geschichten, die fest verwurzelt sind in uralten vorderasiatischen literarischen Traditionen. Der Gilgamesch des Gilgamesch Epos ist keine historische Figur. Er hat den Helden der Flutgeschichte in keiner wirklichen Welt getroffen. Er hat auch nicht wirklich den großen Humbaba getötet, das Monster aus den Zedernwäldern des Libanon. Wir haben keine Ahnung, wer Jesus war, wenn er im ersten Jahrhundert außerhalb der Geschichten, die über ihn geschrieben wurden, wirklich gelebt haben sollte. Wir haben nur diese Geschichten, und keine von ihnen startet im ersten Jahrhundert.
Wie könnte es anders sein, als daß Fragen nach einem historischen Jesus fehl gehen. Vielmehr geht es darum, das Christentum zu legitimisieren als irgendetwas Relevantes über das zu sagen, was die Bibel meinte. (Jesus schafft es in den Tempel hineinzukommen und schmeißt die Geldwechsler raus; was tät er heute wohl mit Ratzinger, Benedikt und der „Banco Spirito di Sancto“?) Ob es jemals einen historischen Jesus gab, wissen wir definitiv nicht. Wir wissen aber: Die Evangelien sind an einem solchen Jesus nicht interessiert. Wirklich alles, was wir heute über Jesus wissen, stammt aus Allegorien, aus fiktiven Geschichten, die fest verwurzelt sind in uralten vorderasiatischen literarischen Traditionen. Der Gilgamesch des Gilgamesch Epos ist keine historische Figur. Er hat den Helden der Flutgeschichte in keiner wirklichen Welt getroffen. Er hat auch nicht wirklich den großen Humbaba getötet, das Monster aus den Zedernwäldern des Libanon. Wir haben keine Ahnung, wer Jesus war, wenn er im ersten Jahrhundert außerhalb der Geschichten, die über ihn geschrieben wurden, wirklich gelebt haben sollte. Wir haben nur diese Geschichten, und keine von ihnen startet im ersten Jahrhundert.
Immer wieder, oft und gerne, gilt Paulus als ein Beispiel für jemanden, der die Jesus-Geschichte als etwas wirklich Geschehenes nahm: „Ist aber Jesus nicht auferstanden, so ist auch euer Glaube vergeblich.“ Das, wahrlich ist eine interessante Formulierung. Tatsächlich nämlich sind ja sein Glaube und der seines „Publikums“ nicht vergeblich. Auf daß Leben den Tod besiege, m u ß Jesus ja auferstanden sein. Paulus w u ß t e nichts von der Auferstehung. Er g l a u b t e daran. Ein Jahrhundert vor Pulus oder vor der Abfassung der Evangelien – bereits in den Qumran Texten – beginnen einige Autoren, die wie Paulus Kommentare oder neue Geschichten auf der Grundlage früherer biblischer Texte schreiben, ihre Geschichten und Erzählungen als Berichte von Ereignissen, insbesondere aber als Prophezeiungen dessen, was bald geschehen wird, abzufassen. Wir dürfen meinen, in der Zeit zwischen den Qumran Texten und der sogenannten Offenbarung des Johannes, die ja wirklich von einem bevorstehenden Tag des Gerichts auszugehen scheint, hat, was den Umgang mit den alten Texten angeht, eine radikale Verschiebung stattgefunden. Im Gegensatz zu einem Tag des Gerichts, als einem Moment in einer niemals endenden Geschichte, nach dem also alles wieder von vorne beginnt, scheint die Offenbarung mit der Geschichte Schluß machen zu wollen. Mit einem alles entscheidenden Sieg bei Armageddon, dem Schauplatz der letzten Entscheidungsschlacht der Könige, dem Sieg über das jüngste Gericht und einer Heimkehr zum Baum des Lebens – für den es zu guter Letzt in der Bibel eine Beschreibung gibt, die einen deutlichen Abstand fordert vom Baum des Satan zugeschriebenen Baum des Wissens. Die Autoren jener Bibelstelle waren ganz offenkundig: Wissende. Was aber haben w i r gelernt? Dies: Der glaub – würdige Gott ist nicht denkbar, ein denk – barer Gott ist nicht glaub- würdig. Die Frage hinter der Frage um das offene Grab bleibt offen. Vermutlich all dessentwegen erweist sich die meiste Theologie bei genauerer Betrachtung als exegetische Paulologie …
Jürgen Gottschling