Satt. Pausbäckig. Diaspora; die SPD im Sturzflug: In den jüngsten Meinungsumfragen findet sich die SPD knapp unter 30 Prozent wieder. Warum kommt sie nicht aus dem Stimmungskeller? Eine Analyse:
Zu Beginn des neuen Jahres vagabundierte wieder einmal die Formel von der „Krise der SPD“ durch die Kommentare der Journaille. Dabei gewann man keineswegs den Eindruck, daß die Sozialdemokraten selbst besonders aufgewühlt reagierten, sich gar erschüttert zeigten und händeringend nach Wegen aus der Misere suchten. Sozialdemokraten haben in den vergangenen Jahrzehnten derart viele Untergangsprognosen zu hören bekommen, daß sie mittlerweile ein abgebrühtes Völkchen bilden.
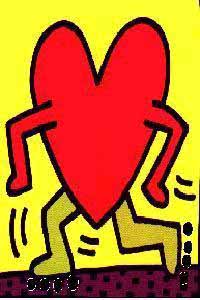 Überdies: Sie haben sich daran gewöhnt, daß sie elektoral in die Zeiten der fünfziger Jahre zurückgefallen sind. Denn: Damit läßt sich durchaus kommod leben. Die Wähleranteile sind zwar wie unter Ollenhauer, aber der Ort der SPD im parlamentarischen System ist inzwischen ein anderer – und somit auch ihr Machtpotential.
Überdies: Sie haben sich daran gewöhnt, daß sie elektoral in die Zeiten der fünfziger Jahre zurückgefallen sind. Denn: Damit läßt sich durchaus kommod leben. Die Wähleranteile sind zwar wie unter Ollenhauer, aber der Ort der SPD im parlamentarischen System ist inzwischen ein anderer – und somit auch ihr Machtpotential.
In der Adenauer-Republik stand die SPD links und so am Rande der Koalitionsfähigkeit. Heute siedelt sie gesellschaftlich und parteipolitisch in der Mitte und bildet für die Regierungsbildung eine Art Scharnier. Es ist im Bund jedenfalls schwer geworden, ohne die Sozialdemokraten zu regieren. Nicht zuletzt deshalb kommen sie auch in der Großen Koalition bestens zurecht. Ihre Minister sind erfahrener, führen die Geschäfte routinierter als ihre Kollegen von der Union. Und so ist die Genugtuung in sozialdemokratischen Gesichtern unübersehbar, dass die Steinbrücks, Steinmeiers und Münteferings die Administration effizienter im Griff haben als die früher gerade chronisch überlegenen Kontrahenten aus den Parteien des Bürgertums.
Doch sind die Probleme, mit denen sich die Partei in der Breite zu plagen hat, in der Tat Legion. Die alte Massenpartei, deren Stolz die Riesenbataillone an treuen Mitgliedern und unermüdlichen Aktivisten war, ist mittlerweile auf die Größe der christdemokratischen Honoratiorenorganisation zugeschrumpft. Auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik stellt sie lediglich in einem Flächenland noch den Ministerpräsidenten. In den prosperierenden modernen Regionen der Republik, von Dresden bis Stuttgart, stecken Sozialdemokraten in einer abgrundtief deprimierenden Diasporasituation fest, verfügen über die Größe einer besseren Sekte. Die strukturelle und auch historische bedingte Unterlegenheit im Süden Deutschlands konnte die SPD einige Jahrzehnte lang noch zwischen Rhein und Ruhr kompensieren, auch in Hessen oder Niedersachsen oder Hamburg. Vorbei das alles. Auch hier liegt die früher robuste Mitglieder – und Organisationspartei weitgehend in Trümmern.
Schreibt man über die SPD, dann verfaßt man eine Geschichte des Verlustes. Perdu sind nicht nur die Mitgliedermassen und der kampagnenkräftige Funktionärskörper. Verschwunden sind ebenfalls die gerade im klassischen Sozialismus so zahlreichen, oft gewiß exzentrischen, aber doch immer farbigen Intellektuellen und Parteitheoretiker. Und radikal entkoppelt haben sich inzwischen die Lebenswelten von Sozialdemokraten und Gewerkschaftern. Beide Sphären haben eine lange Symbiose gebildet, in der sich Betriebserfahrungen und politische Fertigkeiten verknüpften wie ergänzten. Doch heute gehört kein Gewerkschaftsführer mehr der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion an; der lokale Betriebsrat ist nicht mehr zugleich stellvertretender Ortsvereinvorsitzender und Mitglied der Stadtratsfraktion der SPD. Friktionen hat es zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokraten historisch immer wieder gegeben. Aber die heillose Entfremdung, wie sie sich seit 1999 entwickelt hat, ist geschichtlich neu – zumal ein gewichtiger Teil des gewerkschaftlichen Mittelbaus nunmehr einen finalen politischen Repräsentanzwechsel von der SPD dort vollzogen hat. Aber auch das irritiert die Sozialdemokraten nicht im Geringsten.
Wahrscheinlich ist es das, was der SPD am meisten schadet: die Attitüde der satten Zufriedenheit, der selbstgefälligen Arriviertheit, der parvenuhaften Pausbäckigkeit von Mandatsträgern. In den früheren Jahrzehnten agierten die Sozialdemokraten häufig ungeschickt. Ihre zelotischen Flügelstreitigkeiten nervten oft. Ihr Mangel an machtpolitischer Raffinesse wirkt zuweilen mitleidserregend. Und doch umwehte diese über ein Jahrhundert hinweg notorische Oppositionspartei eine spezifische, durchaus anrührende Aura: Partei der Nichtprivilegierten zu sein, die für die Emanzipation der Outcasts kämpfte und für die Würde der unteren Schichten eintrat.
Man nahm diese Haltung der SPD ab, weil ihre Mitglieder, Funktionäre und Parlamentarier selbst zu den Outcasts zählten, aus den unteren Schichten kamen und politisch nicht zu den Privilegierten gehörten. Doch das hat sich gründlich geändert; und eben dies markiert die entscheidende Zäsur in der sozialdemokratischen Geschichte. Mindestens in ihrem Funktionärs – und Mandatsbereich ist die Sozialdemokratie die Partei der Aufstiegsgewinner, derjenigen also, die es durch Leistung und sozialstaatliche Förderung in den mittlerweile schon einige Zeit zurückliegenden wohlfahrtsstaatlichen Jahren geschafft haben, die Proletarität hinter sich zu lassen. Seither ist innerparteilich außerdem noch eine Kohorte nachgerückt, die sogleich – ohne die Mühsal zweiter Bildungswege und ohne Erfahrung in Berufen jenseits der Politik – geradewegs, nahezu konkurrenzlos und rasch im Parlamentsbetrieb nach oben gekommen ist. Die programmatischen Losungen der Sozialdemokraten des Jahres 2007 – Bildung, lebenslanges Lernen, Chancen, Leistung – spiegeln die Lektion aus den erfolgreichen Biographien sozialdemokratischer Aufsteiger der bundesdeutschen Wohlfahrtsstaatsära. Aber sie haben mit den neuen Erlebnissen des Scheiterns, der Demütigung oder wie es heute gerne heißt: der Prekarität durch Bildungsversagen in den diskontinuierlichen Lebenszusammenhängen des unteren Drittels im Globalisierungskapitalismus nichts zu tun.
Die Sozialdemokraten sind eben tatsächlich Mitte geworden. Ihre Bildungsphilanthropie kopiert das liberale Bildungsverständnis des 18. Jahrhunderts, von dem sich die Partei August Bebels seinerzeit gelöst hatte. Ihre individualitätsbezogene Leistungs – und Chancenrethorik ist genuin christdemokratischen Vorstellungen entnommen, gegen das die klassische Sozialdemokratie der Vor-Enkel-Ära noch ihre eigene kollektive Emanzipationsidee gestellt hatte.
Aber so ist das eben: Parteien haben Erfolg. Und mit den Erfolgen entfernen sie sich unweigerlich von den Voraussetzungen ihres originären Anliegens, ihres primären Flairs, ihres anfänglichen Ethos. Man mag daher sagen, daß im Erfolg durch die Erosion des Ursprungs auch die Krise lauert. Aber als Krise empfinden die empirischen Sozialdemokraten des Jahres 2007 ihre Lage gar nicht. Sie sind vielmehr mit ihrer Position rundum zufrieden.
Franz Walter
Der Autor ist Professor für Parteienforschung. Er lehrt in Göttingen. Zuletzt erschien von ihm „Träume von Jamaika“ bei Kiepenheuer & Witsch
16.März.2007, 17:53
Good, better, best, let us never rest,
till our good is better and our better best.
16.März.2007, 18:14
Von der Beruhigung zur Lähmung einer Partei ist es nur ein kleiner Schritt – dann kommt auch schon die Panik.
20.März.2007, 19:48
hallo freunde der sonne,
habe den artikel „der klassen-kampf beginnt“ in der rnz gelesen. auf gut deutsch: kann man alles wieder falten, das wird nichts mit der hiesigen spd.
gelangweilte parteidelegierte. wenig applaus. und der streit geht auf personen-ebene weiter, auch wenn es keine lager mehr geben soll. von inhalt war komischerweise gar nicht die rede, und wenn ich richtig verstehe, galt das klaro für beide kandidaten auf den parteivorsitz.
schade, werde wohl in zukunft dann nur noch die grünen hier vor ort wählen, auch wenn wir in meiner familie im guten alten ruhrpott eigentlich sozis sind.
ciao simon
18.Juli.2007, 14:16
Ich habe einee grosse familie – und ich komme aus Köln.