Großer Premierenapplaus und Bravi für das Ensemble, Ute Richters Regie und den Autor.
Was wäre das für ein Leben, die tröstliche Gewißheit der Erlösung durch den Tod nicht haben zu dürfen. Daß die Liebe den Tod (unser alter ego schließlich) endlich am Ende besiegte, wer könnte das wirklich wollen …
18 Monate mehr Leben der Liebe wegen als Geschenk, das muß trotz – wenngleich nicht wegen- unheilbarer Krankheit angenommen werden dürfen; so endet das Stück lebens-liebenswert, nicht ohne uns mit der wittgensteinschen Erkenntnis alleine zu lassen, es habe das Leben etwas von einem Messer ohne Klinge, an dem der Griff fehlt.
Michael McKeevers „Willkommen in deinem Leben“ (Running with Scissors) bringt – eingewoben in einen dichten Handlungsstrang – ein intim gesponnenes Beziehungsgeflecht auf die Bühne.
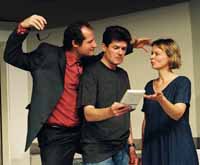 Hier wird der (leibhaftig auftretende) Tod nicht einmal von der auch real erscheinenden Liebe aus dem Leben verdrängt, er tummelt sich (Tod „Wally“ wird von Ulrich Gall wunderschön zynisch-perfide als liebenswerter Fiesling gegeben) im Leben des mittelmäßigen Lektors Charly Cox, den Hans Zwimpfer glaubhaft-gradlinig wie vom Autor vorgegeben großartig-zuverlässig als „personalifizierter Durchschnitt“ auf die Bretter bringt, „verwaschen und traurig“ – und der einen Tod bereits gestorben ist: „Hast gekniffen“, reizt ihn der Tod, „hast den Schwanz eingezogen, bist Lektor geworden, statt Schriftsteller – Angst vorm Versagen in einer Haifischbecken-Industrie“. – Als wollte der Tod den Versager seinen nächsten Tod leichter sterben lassen …
Hier wird der (leibhaftig auftretende) Tod nicht einmal von der auch real erscheinenden Liebe aus dem Leben verdrängt, er tummelt sich (Tod „Wally“ wird von Ulrich Gall wunderschön zynisch-perfide als liebenswerter Fiesling gegeben) im Leben des mittelmäßigen Lektors Charly Cox, den Hans Zwimpfer glaubhaft-gradlinig wie vom Autor vorgegeben großartig-zuverlässig als „personalifizierter Durchschnitt“ auf die Bretter bringt, „verwaschen und traurig“ – und der einen Tod bereits gestorben ist: „Hast gekniffen“, reizt ihn der Tod, „hast den Schwanz eingezogen, bist Lektor geworden, statt Schriftsteller – Angst vorm Versagen in einer Haifischbecken-Industrie“. – Als wollte der Tod den Versager seinen nächsten Tod leichter sterben lassen …
Die Liebe (Katharina Waldau gibt diese „Himmelsmacht“ köstlich verzickt an einem Hauch von Vamp) und der Tod – der Autor läßt die beiden, verkämpft um die Seele des Charly, inhaltsschwanger philosophische Dialoge ablegen; und derweil Kiki, Charlys persönliche Liebe, ihn wissen läßt, er habe mit Nell (Miriam Gruden: bezaubernd – ganz verstehende, liebende Frau) seine, welch ein Untschied, große Liebe getroffen – die das winzige Hotel irgendwo im Nirgendwo leitet, in dem sich das alles abspielt, findet der Tod das eher „zum Kotzen“. Charly gehöre ihm, meint er und warnt Kiki, die Liebe, sie möge ihm „nicht ins Gehege“ kommen. Daß in all diesem Kuddelmuddel auch noch ein Automechaniker (mit älteren Rechten) mitzuspielen versucht (Sven Schöcker gibt ihn gediegen, brav und gottergeben), verknotet den Handlungsstrang um noch ein Quäntchen mehr.
 Ute Richter inszeniert den Text mit glasklarem Blick und einer großen Gelassenheit, sie skelettiert das Stück auf seine verborgenen Motive, legt die hinter den Worten verborgene Partitur der Gefühle frei und überträgt sie in stimmig-schöne Bilder. Diese Produktion erinnert an den Fluß Leben, der sich in mäandernden Bewegungen mal von der Liebesgeschichte (die McKeevers Stück ja auch ist) entfernt, mal sich ihr wieder annähert. Kurze szenische Halluzinationen, zwischen denen sich, wie eine Blende, immer wieder kurz das Dunkel öffnet – und schließt. Richters Regiekonzept vermittelt, über den reinen Text hinaus, ein emanzipatorisches Moment des Theaters. Etwa, wenn Nell Charly erzählt, wie sie als Kinder am Ende des Winters die Hügel angezündet haben, wie „das Feuer die ganzen alten Halme und das welke Gras vernichtet und nur die Saat übrig gelassen“ habe, und im Frühjar dann die Saat grünte und die Hügel mit unglaublicher Macht anfingen wieder zu leben – da erinnern wir uns der Shakespeareschen Julia: „Und stirbt er einst, zerteil in kleine Sterne ihn. Er wird des Himmels Antlitz so verschönen, daß alle Welt sich in die Nacht verliebt und niemand mehr der eitlen Sonne huldigt.“
Ute Richter inszeniert den Text mit glasklarem Blick und einer großen Gelassenheit, sie skelettiert das Stück auf seine verborgenen Motive, legt die hinter den Worten verborgene Partitur der Gefühle frei und überträgt sie in stimmig-schöne Bilder. Diese Produktion erinnert an den Fluß Leben, der sich in mäandernden Bewegungen mal von der Liebesgeschichte (die McKeevers Stück ja auch ist) entfernt, mal sich ihr wieder annähert. Kurze szenische Halluzinationen, zwischen denen sich, wie eine Blende, immer wieder kurz das Dunkel öffnet – und schließt. Richters Regiekonzept vermittelt, über den reinen Text hinaus, ein emanzipatorisches Moment des Theaters. Etwa, wenn Nell Charly erzählt, wie sie als Kinder am Ende des Winters die Hügel angezündet haben, wie „das Feuer die ganzen alten Halme und das welke Gras vernichtet und nur die Saat übrig gelassen“ habe, und im Frühjar dann die Saat grünte und die Hügel mit unglaublicher Macht anfingen wieder zu leben – da erinnern wir uns der Shakespeareschen Julia: „Und stirbt er einst, zerteil in kleine Sterne ihn. Er wird des Himmels Antlitz so verschönen, daß alle Welt sich in die Nacht verliebt und niemand mehr der eitlen Sonne huldigt.“
Auch McKeever läßt seine Protagonisten ein Nachsinnen verkörpern, das Wirkliches als Idee wie als Realität immer wieder unter dem Aspekt der Hinfälligkeit vermißt. Was aber geschieht unserem Geist, da wir zu grübeln beginnen? Welche Energien werden wirksam, wenn wir uns vom Alltag ab- und der Meditation über Leben und Tod und das Mißlingende allen Wissens zuwenden?“
„Wie kommt es, denken wir mal mit Novalis, „daß wir nach den Seufzern der Phantasie und dem Überschwang des Denkens sterben müssen? Wie kommt es, daß wir zugleich in und außerhalb
dieser Welt sind?“
 Geben wir uns eine Chance: McKeevers tragische Komödie setzt im Persönlichsten an, mitten in der Paradoxie einer künftigen Trauer, die das Wort in der Kehle erstickt. Mitten in jener Endgültigkeit, an der sich das Denken entzündet und in der es armselig auch wieder verlöscht. Also, wer könnte wirklich (wirklich) wollen, daß die Liebe am Ende den Tod besiegte? Auch, wenn wir Menschen das Nichts so sehr verabscheuen, ist das doch nur ein anderer Ausdruck davon, daß wir so sehr das Leben wollen und nichts kennen als eben diesen Willen, dessen Gestalt wir selbst sind: „Jener Friede, der höher ist denn alle Vernunft“, jene gänzliche Stille, jene tiefe Ruhe, jene unerschütterliche Zuversicht und Heiterkeit …
Geben wir uns eine Chance: McKeevers tragische Komödie setzt im Persönlichsten an, mitten in der Paradoxie einer künftigen Trauer, die das Wort in der Kehle erstickt. Mitten in jener Endgültigkeit, an der sich das Denken entzündet und in der es armselig auch wieder verlöscht. Also, wer könnte wirklich (wirklich) wollen, daß die Liebe am Ende den Tod besiegte? Auch, wenn wir Menschen das Nichts so sehr verabscheuen, ist das doch nur ein anderer Ausdruck davon, daß wir so sehr das Leben wollen und nichts kennen als eben diesen Willen, dessen Gestalt wir selbst sind: „Jener Friede, der höher ist denn alle Vernunft“, jene gänzliche Stille, jene tiefe Ruhe, jene unerschütterliche Zuversicht und Heiterkeit …
Dem Anlaß sicher zum Tod führender Krankheit des Charlie Cox geschuldet, trotz des wartenden Todes, der tändelnd-realen Liebe auch und alledem zum Trotz, ist „Willkommen in deinem Leben“ von einer – wenn schon dann eher – gelassenen Sorge, einer Art Versprechen an den Menschen, erfüllt.
Zwei Männer, eine Frau, die Liebe und ein bißchen Tod, Einsamkeit, Melancholie und Verwandtes – nichts Ernstes also im Grund. Der Autor erzählt vom Tod. Ja. Aber es ist kein trauriges Stück.
Hingegen tut dieser Theaterabend vor allem eines, was ja vielleicht auch eine ursprüngliche Aufgabe von Theater ist: er spendet fröhlichen Trost. Und schafft eine Verbindung zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt. Hier wird um jede Seele gekämpft. Und zwar bis Ende Januar – in diesem Theater.