Wie sollten die Geisteswissenschaften gefördert werden?
Für die natur- und technikwissenschaftliche Forschung wird viel, für die geisteswissenschaftliche Forschung wird weniger, aber auch nicht wenig Geld ausgegeben. Werden die Forschungsmittel für die Geisteswissenschaften jedoch auch in vernünftiger Weise vergeben?
 Die politischen Systeme in Europa scheinen von einer Bildungseuphorie erfaßt zu sein. In Deutschland wird eine «Exzellenzinitiative» ausgelobt, die EU hebt ihre Bildungsausgaben deutlich an. Allenthalben ist klar: Bei Bildung und Forschung darf nicht gespart werden. Das ist löblich. Fragt man aber, weshalb dort denn eigentlich nicht gespart werden dürfe, dann zeigen sich Anzeichen, die diese Euphorie trüben können. Bildung und Forschung werden in der Regel nicht um ihrer selbst – um der Freiheit der Wissenschaft – willen gefördert, wie es die Universitäten von ihrer Tradition her gewohnt wären, sondern weil von ihnen die zukünftige wirtschaftliche Prosperität Europas unmittelbar abhänge.
Die politischen Systeme in Europa scheinen von einer Bildungseuphorie erfaßt zu sein. In Deutschland wird eine «Exzellenzinitiative» ausgelobt, die EU hebt ihre Bildungsausgaben deutlich an. Allenthalben ist klar: Bei Bildung und Forschung darf nicht gespart werden. Das ist löblich. Fragt man aber, weshalb dort denn eigentlich nicht gespart werden dürfe, dann zeigen sich Anzeichen, die diese Euphorie trüben können. Bildung und Forschung werden in der Regel nicht um ihrer selbst – um der Freiheit der Wissenschaft – willen gefördert, wie es die Universitäten von ihrer Tradition her gewohnt wären, sondern weil von ihnen die zukünftige wirtschaftliche Prosperität Europas unmittelbar abhänge.
Kritische Refelxion gefragt
Nun könnte man argumentieren, daß es den Universitäten gleichgültig sein könne, aus welchen Gründen und Motiven sie gefördert werden, solange es nur getan wird. Dieses opportunistische Argument ist zwar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, aber die hinter der Unterstützung der Universitäten stehenden Gründe wirken sich – je länger, je mehr – auf die Art und Weise, wie sie gefördert werden, aus; und dieser Prozeß verlangt eine kritische Reflexion. Immerhin geht es um die Allokation beträchtlicher öffentlicher Mittel.
Der keineswegs illegitime Subtext der Bildungsförderung, jedenfalls im Hochschulbereich, lautet im Insiderjargon «Info-Nano-Bio». Hier geben sich Wissenschaft, Wirtschaft und Politik die Hand. Es sind im Wesentlichen die Naturwissenschaften, deretwegen sich die Universitäten ungebrochener finanzieller Zuwendung erfreuen können. Davon profitieren im kulturbewußten Europa, zumindest in einer diskutablen Proportionalität, auch die Geisteswissenschaften. Das ist erfreulich. Nur: Sie werden oft so gefördert, als wenn sie Naturwissenschaften wären. Finanziert werden Graduiertenschulen, Forschungsgruppen, «Exzellenzcluster», Kompetenzzentren, und zwar auf Antragstellung. Im Rahmen eines kompetitiven Auswahlverfahrens wird dann dieses oder jenes Projekt bewilligt.
Nun entbehrt dieses System nicht der Logik, und es hat auch in den Geisteswissenschaften einiges bewegt: Konvergenzen zwischen vergleichbaren Fragestellungen unterschiedlicher Disziplinen wurden sichtbar, Promovierende sind in interdisziplinäre Diskursgemeinschaften eingebunden worden; die Antragstellenden waren gehalten, sich zu überlegen, wo sich neue wissenschaftliche Netzwerke ergeben können oder sollen. Die Geisteswissenschaften sind insgesamt kommunikativer und interdisziplinärer geworden.
Doch die Förderung der Geisteswissenschaften ist optimierbar. Bei den bisherigen Maßnahmen haben sich vor allem die folgenden Probleme gezeigt: Erstens wird vorrangig kollektive Forschung gefördert. Um Geld zu erhalten, muß der Antragsteller eine Forschergruppe repräsentieren oder ein Graduiertenkolleg, oder man muß eine Doktorandenschule einrichten wollen. Natürlich können solche kollektiven Organisationsformen, die vor allem in der naturwissenschaftlichen Forschung eine wichtige Rolle spielen, auch in den Geisteswissenschaften Resultate hervorbringen. Gleichwohl bleibt zu bedenken, daß die Geisteswissenschaften ihre bedeutendsten Fortschritte bisher durch individuelle Forschung erzielt haben. Die wichtigste Ressource für diese Art von Forschung ist Zeit. Sie kostet auch Geld, denn die Forschenden müssen für bestimmte Zeitspannen aus ihren akademischen Verpflichtungen «herausgekauft» werden. Diese Forschungsförderung ist noch kaum institutionalisiert worden. Gerade im vielzitierten Vergleich mit den USA besteht an diesem Punkt für europäische Geisteswissenschaften Aufholbedarf, wenn sie in den globalen kulturellen Diskursen weiterhin mit Gewicht mitreden wollen.
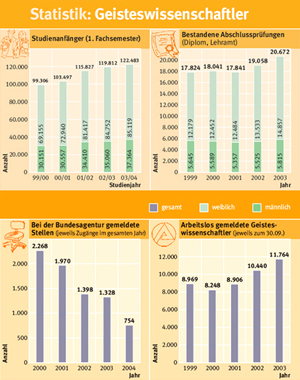 Zweitens: Es ist richtig, daß Forschungsgelder, wie dies bisher vorrangig vorgesehen ist, auch in kompetitiven Auswahlverfahren verteilt werden, die über Anträge laufen. Dieses Vorgehen kann mitunter allerdings eher feudale als demokratische Züge tragen. Es ist aber vor allem dann kritisch zu prüfen, wenn ein ansehnlicher Anteil dessen, was ein Geisteswissenschafter schreibt, Antragsprosa ist – seinen wissenschaftlichen Publikationen kann er sich so immer weniger zuwenden. An ihre administrativen Grenzen stoßen die Geisteswissenschaften vor allem, wenn sie aus den europäischen Geldtöpfen schöpfen wollen. Hundertseitige Anträge sind keine Seltenheit, das Vorgehen ist von einer solchen Komplexität, daß diese Mittel einem esoterischen Zirkel von Eingeweihten vorbehalten bleiben.
Zweitens: Es ist richtig, daß Forschungsgelder, wie dies bisher vorrangig vorgesehen ist, auch in kompetitiven Auswahlverfahren verteilt werden, die über Anträge laufen. Dieses Vorgehen kann mitunter allerdings eher feudale als demokratische Züge tragen. Es ist aber vor allem dann kritisch zu prüfen, wenn ein ansehnlicher Anteil dessen, was ein Geisteswissenschafter schreibt, Antragsprosa ist – seinen wissenschaftlichen Publikationen kann er sich so immer weniger zuwenden. An ihre administrativen Grenzen stoßen die Geisteswissenschaften vor allem, wenn sie aus den europäischen Geldtöpfen schöpfen wollen. Hundertseitige Anträge sind keine Seltenheit, das Vorgehen ist von einer solchen Komplexität, daß diese Mittel einem esoterischen Zirkel von Eingeweihten vorbehalten bleiben.
Wettbewerb und Bürokratie
Weiter kostet die Verwaltung dieser Anträge einiges an Geld, das so nicht in die Forschung fließen kann. Deshalb benötigen geisteswissenschaftliche Professuren eine solide Grundausstattung, die es ihnen ermöglicht, ohne aufwendige Antragsverfahren gute Forschung zu betreiben. Diese Grundausstattung ist im Übrigen, gemessen an naturwissenschaftlichen Standards, nicht sehr teuer. Forschungsförderung darf und soll auch kompetitiv sein, wenn sie aber statt der Stimulierung des Wettbewerbs in beträchtlichem Ausmaß der Finanzierung der Verwaltung von Forschung und von Antragsarbeit dient, dann sind diese Mittel nicht optimal eingesetzt.
Drittens: Naturwissenschaften sind technisch verwertbar, deshalb können Forschungsprogramme anwendungsorientiert ausgeschrieben werden. Dies geschieht mehr und mehr auch für die Geisteswissenschaften. Natürlich lassen sich auch geisteswissenschaftliche Erkenntnisse politisch, sozial oder ökonomisch verwerten. Doch geisteswissenschaftliche Forschung muß, will sie ihre erkenntnisfördernden und kritischen Funktionen voll entfalten, frei sein – wie dies übrigens auch in beträchtlichem Maß für die Naturwissenschaften gilt. Das heißt: Geisteswissenschaften benötigen – zusätzlich zu anwendungsorientierten Programmen – vermehrt nicht zielgebundene Beiträge, gerade wenn sie die geistige und kulturelle Zukunft der Welt mitgestalten sollen.
Geisteswissenschaftliche Förderung erweitern
Viertens: Geisteswissenschaftliche Förderung ist vor allem für den wissenschaftlichen Nachwuchs erhältlich. Es ist richtig, hierfür Geld einzusetzen. Auf Kosten des wissenschaftlichen Nachwuchses darf nicht gespart werden, denn er ist das akademische Potential der Zukunft. Es gibt aber spezifische Probleme in den Geisteswissenschaften, die nicht sinnvollerweise durch Projekte bearbeitet werden können, die gleichzeitig akademische Qualifikationsschriften hervorbringen sollen, sondern eine fortgeschrittene Professionalisierung und wissenschaftliche Erfahrung voraussetzen.
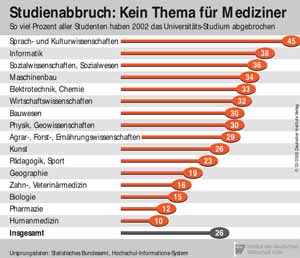 Die Palette geisteswissenschaftlicher Förderung ist deshalb zu erweitern: Sie sollte Einzelnen zusätzliche Forschungsfreiräume ermöglichen; sie sollte neben der anwendungsorientierten Forschung stärker noch als bisher die freie Forschung berücksichtigen; sie sollte ihre Mittel nicht ausschließlich auf dem Antragswege (und durch entsprechende Bürokratien) vergeben; und sie sollte auch vermehrt Projektmöglichkeiten für etablierte Forschende vorsehen. Sind diese Forderungen mehr als nur ein etwas zu ausführlich geratener Wunschzettel der Geisteswissenschaften? Dazu ist zu bemerken: Auch in die Geisteswissenschaften fließt viel Geld, es ist schade um jeden Euro, der keine sachgemäße Verwendung findet. Nur: «Info-Nano-Bio» wird uns zwar wirtschaftlich- wer aber geistig weiterbringen? Jürgen Gottschling
Die Palette geisteswissenschaftlicher Förderung ist deshalb zu erweitern: Sie sollte Einzelnen zusätzliche Forschungsfreiräume ermöglichen; sie sollte neben der anwendungsorientierten Forschung stärker noch als bisher die freie Forschung berücksichtigen; sie sollte ihre Mittel nicht ausschließlich auf dem Antragswege (und durch entsprechende Bürokratien) vergeben; und sie sollte auch vermehrt Projektmöglichkeiten für etablierte Forschende vorsehen. Sind diese Forderungen mehr als nur ein etwas zu ausführlich geratener Wunschzettel der Geisteswissenschaften? Dazu ist zu bemerken: Auch in die Geisteswissenschaften fließt viel Geld, es ist schade um jeden Euro, der keine sachgemäße Verwendung findet. Nur: «Info-Nano-Bio» wird uns zwar wirtschaftlich- wer aber geistig weiterbringen? Jürgen Gottschling
Kurzbiographien Autoren „Zukunft der Geisteswissenschaft“
Ulrich Arnswald (Herausgeber):
Arnswald studierte in Heidelberg, Paris, Canterbury und London die Fächer
Volkswirtschaftslehre, Politische Wissenschaften und Philosophie. Nach dem
Studium folgten Arbeitsaufenthalte in Tokio und Dublin. Verschiedene Lehr-
und Forschungsaufträge führten ihn nach Großbritannien, Norwegen und in die
Türkei. Von 1997 bis 2006 war er Gründungsdirektor des European Institute
for International Affairs Heidelberg. Derzeit ist er als Werbebeauftragter
für Politische Philosophie an der TU Darmstadt und der Uni Karlsruhe (TH).
Für weitere Informationen siehe: http://www.ulrich-arnswald.de
Reinhardt Brandt:
Brandt studierte Latein, Griechisch und Philosophie in Marburg, München und
Paris. Er promovierte 1965, von 1972 an hatte er eine Professur für
Philosophie in Marburg inne. Verschiedene Lehraufträge führten ihn unter
anderem nach Venezuela, Italien und Australien. Er ist Ordentliches Mitglied
der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Universität Frankfurt und
korrespondierendes Mitglied der Akademie zu Göttingen. Dazu kommen noch
zahlreiche Mitgliedschaften in in- und ausländischen Beiräten.
Er gründete gemeinsam mit Werner Stark das Marburger Kant-Archiv, dessen
Ziel es ist, den Verbleib Kantischer Texte zu dokumentieren.
Für weitere Informationen siehe: http://www.staff.uni-marburg.de/~brandt2/
Peter Frankenberg
Frankenberg ist derzeit Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst in
Baden-Württemberg. Von 1994 bis 2001 war der promovierte Geograph Rektor der
Universität Mannheim. Studiert hat er Geschichte, Geographie, Geologie und
Botanik an der Universität Bonn.
Er war außerdem Vizepräsident für Forschung der Hochschulrektorenkonferenz
und Mitglied in verschiedenen in- und ausländischen Gremien zur
Hochschulentwicklung.
Für weitere Informationen siehe:
http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/ministerium/personen/minister-peter-fra
nkenberg/
Klaus Landfried:
Vor seiner Promotion studierte Landfried Volkswirtschaftslehre, Geschichte,
Neuere Deutsche Literaturgeschichte, Öffentliches Recht und
Politikwissenschaft in Basel und Heidelberg. Seit 1974 hatte er eine
Professur für Politikwissenschaft an der Uni Kaiserslautern inne. Von 1994
bis 1998 Vorstandsmitglied der Association of European Universities, von
1997 bis 2003 Präsident der deutschen Hochschulrektorenkonferenz.
Julian Nida-Rümelin:
Der gebürtige Münchner studierte Philosophie, Physik, Mathematik und
Politikwissenschaft und promovierte in Philosophie. Nach seiner Habilitation
1989 hatte er zunächst eine Gastprofessur in den USA inne und übernahm
anschließend einen Lehrstuhl für Ethik in den Biowissenschaften (Tübingen)
sowie für Philosophie (Göttingen). Für die Stadt München war Nida-Rümelin in
den Jahren 1998 bis 2003 als Kulturreferent tätig; in den Jahren 2001/02
gehörte er als Kulturstaatsminister der Bundesregierung an. Seit 2004 hat er
den Lehrstuhl für politische Theorie und Philosophie an der LMU München
inne. Für weitere Informationen siehe: http://www.nida-ruemelin.de/
Hans-Peter Schütt:
Schütt ist Professor für Philosophie an der Uni Karlsruhe (TH). Er leitet
das Institut für Philosophie und ist Prodekan der Fakultät für Geistes- und
Sozialwissenschaften. Er studierte in Hamburg Mathematik, Philosophie und
klassische griechische Philologie. Anschließend war er als Lehrer tätig. Von
1977 bis 1994 war er am Philosophischen Seminar der Uni Heidelberg als
Wissenschaftlicher Angestellter, Lehrbeauftragter und Hochschuldozent tätig.
Es folgten mehrere Lehrstuhlvertretungen in Göttingen, Hamburg und
Karlsruhe. Seit 1995 hat er einen Lehrstuhl an der Uni Karlsruhe inne. Für
weitere Informationen siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Peter_Sch%C3%BCtt