 Das deutsche Goethe Institut e.V. hat sich der „Pflege der deutschen Sprache im Ausland“ und der „Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit“ verschrieben. Rund 3.300 Mitarbeiter in 75 Ländern an 129 Instituten von Abidjan bis Zagreb verbreiten deutsche Kultur in Wort, Bild und Ton. Gesteuert wird das Unternehmen von der „Zentralverwaltung“ in München, wo eine Abteilung für „Rechtsangelegenheiten“ darüber wacht, daß kein Unbefugter mit Goethe Unfug treibt. Darum sitzt der Berliner Künstler Wolfgang Müller in seiner 45 Quadratmeter großen Kreuzberger Altbauwohnung und reagiert weder auf Klopf- noch Klingelzeichen. Zu erreichen ist er über eine Handynummer, die er nur an gute Freunde weiter gibt. Der einfallsreiche aber nicht gerade wohlhabende Künstler fürchtet den Besuch eines Gerichtsvollziehers, der ihm eine einstweilige Verfügung überreichen könnte. Goethes amtliche Erben nämlich wissen zwar, wie man die deutsche Sprache im Ausland pflegt und kulturelle Beziehungen fördert, doch für Humor und Selbstironie haben sie noch kein Referat eingerichtet.
Das deutsche Goethe Institut e.V. hat sich der „Pflege der deutschen Sprache im Ausland“ und der „Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit“ verschrieben. Rund 3.300 Mitarbeiter in 75 Ländern an 129 Instituten von Abidjan bis Zagreb verbreiten deutsche Kultur in Wort, Bild und Ton. Gesteuert wird das Unternehmen von der „Zentralverwaltung“ in München, wo eine Abteilung für „Rechtsangelegenheiten“ darüber wacht, daß kein Unbefugter mit Goethe Unfug treibt. Darum sitzt der Berliner Künstler Wolfgang Müller in seiner 45 Quadratmeter großen Kreuzberger Altbauwohnung und reagiert weder auf Klopf- noch Klingelzeichen. Zu erreichen ist er über eine Handynummer, die er nur an gute Freunde weiter gibt. Der einfallsreiche aber nicht gerade wohlhabende Künstler fürchtet den Besuch eines Gerichtsvollziehers, der ihm eine einstweilige Verfügung überreichen könnte. Goethes amtliche Erben nämlich wissen zwar, wie man die deutsche Sprache im Ausland pflegt und kulturelle Beziehungen fördert, doch für Humor und Selbstironie haben sie noch kein Referat eingerichtet.
„Ich will es auf keinen Fall auf einen Prozeß ankommen lassen“, sagt Müller, der 1957 in Wolfsburg geboren wurde und seit 198o in Berlin lebt, „ich kann mir keinen leisten und ich möchte nicht, daß Goethe noch mehr Planstellen abbauen muß, um Geld für Anwälte zu haben“.
Müllers Gerangel mit dem Goethe-Institut begann vor genau drei Jahren. Im März 1998 wurde das Goethe-Institut in Reykjavik geschlossen. Fünf Monate später, im August 1998, machte Müller im Living Art Museum der isländischen Hauptstadt das „erste private Goethe-Institut der Welt“ auf; es war eine „Installation“, bestehend aus einem Schreibtisch, einem Blumentopf und einem Telefon, das immer dann klingelte, wenn die alte Nummer des geschlossenen Instituts angewählt wurde.
Der Schelmenstreich fand nicht nur viel Resonanz in der deutschen Presse, auch das Goethe-Institut war positiv angetan. „Wir finden das Projekt originell“, erklärte der damalige Pressesprecher, „schön, daß jemand mit den Mitteln der Kunst auf ein politisches Problem aufmerksam macht“. Während Ende 1998 in Reykjavik mit deutscher Hilfe ein privates Goethe-Zentrum auf Sparflamme eingerichtet wurde, machte Müller, der einen ausgeprägten Island-Tick hat, auf eigene Faust weiter. Im Oktober 1999 organisierte er im Berliner „Podewil“ eine Multimedia-Performance mit isländischen Literaten und Musikern; im August 2ooo eröffnete er im „Gelben Haus“, dem ersten und einzigen besetzten Haus Reykjaviks, die Ausstellung „Goethes isländische Reise“, eine Parodie auf die Italien-Reise des Dichters, mit Arbeiten von zwei Dutzend Künstlern. Ursprünglich wollte das Goethe-Zentrum dieses Projekt fördern, jedoch blieb es bei einer vagen und dann nicht realisierten Zusage.
 Seit einigen Monaten tritt „der geschäftsführende Direktor des privaten Goethe-Instituts Reykjavik“ mit einer eigenen Show auf, „Neues von der Elfenfront“, so etwa im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Müller „referiert und singt“, zuletzt brachte er eine eigene CD heraus, „Ich habe sie gesehn … Elfen, Zwerge und Feen“, auf der er (unter anderem) ein isländisches „Loblied auf den Wein“ bringt – (ob Goethen wohl sein Bild zur linken veröffentlicht zu sehen Bedenken gehabt haben würde? – Wohl kaum, wünschen wir denken zu dürfen.
Seit einigen Monaten tritt „der geschäftsführende Direktor des privaten Goethe-Instituts Reykjavik“ mit einer eigenen Show auf, „Neues von der Elfenfront“, so etwa im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Müller „referiert und singt“, zuletzt brachte er eine eigene CD heraus, „Ich habe sie gesehn … Elfen, Zwerge und Feen“, auf der er (unter anderem) ein isländisches „Loblied auf den Wein“ bringt – (ob Goethen wohl sein Bild zur linken veröffentlicht zu sehen Bedenken gehabt haben würde? – Wohl kaum, wünschen wir denken zu dürfen.
Ob aber Müller mit alledem die deutsch-isländische Symbiose zu weit getrieben hatte oder ob ein „Bereichsleiter“ in der Goethe-Zentrale plötzlich einen dringenden Handlungsbedarf entdeckte – warum auch immer bekam der Berliner Island-Fan Müller Mitte März einen Brief („Einschreiben / Rückschein“) aus München, in dem es um die „Verwendung der Marke Goethe-Institut“ ging. Diese sei, wurde er belehrt, „seit 1991 im Markenregister eingetragen“ und somit „gegen jede Benutzung durch Dritte geschützt“; es bestehe „eine Verwechslungsgefahr“; außerdem stelle Müllers Verhalten „einen Eingriff in den ausgeübten und eingerichteten Gewerbebetrieb dar“, eine Handlung, die das Goethe Institut „ebenfalls zum Schadenersatz“ berechtige.
Dem Schreiben lag eine „Unterlassungs verpflichtungs- erklärung“ bei, die Müller unterschreiben und bis zum 3o. März zurückschicken sollte: „Bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von DM 10.001 für jeden Fall der Zuwiderhandlung“. Das große (Jahresumsatz über 3oo Millionen Mark), auf Kultur bedachte Goethe-Institut gab sich als ein „Gewerbebetrieb“ zu erkennen, der die Gefahr abwehren muß, mit einem Konkurrenten verwechselt zu werden, der grade eben 3o.ooo Mark im Jahr umsetzt. Nicht einmal der Konzern „Kentucky Fried Chicken“ kam auf eine solche Idee, als die Komiker der SAT 1-Wochenshow den Firmennamen in „Kentucky schreit ficken“ abwandelten. Müller wandte sich brieflich an den Präsidenten des Goethe Instituts, Hilmar Hoffmann, und machte den Frankfurter Feingeist („Kultur für alle!“) darauf aufmerksam, sein Projekt „privates Goethe Institut Reykjavik“ sei „eine rein künstlerische Arbeit“; als „freischaffender Künstler ohne festes Einkommen“ habe er „kein Interesse an einer gerichtlichen Auseinandersetzung“; Hoffmann, damit beschäftigt, Goethe vor dem finanziellen Ruin zu retten, fand nicht einmal Zeit für eine Antwort.
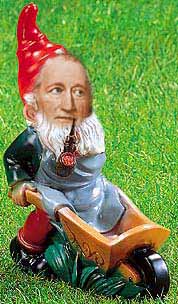 Nach dem ersten Schrecken hat sich Müller wieder gefangen. Um seinen guten Willen zu demonstrieren, hat er auf der Homepage von www.geysir.com sein Projekt umbenannt. Es heißt nun „Walther von Goethe Foundation Reykjavik“, nach dem letzten Enkel von Goethe, der an seinem Großvater gelitten hat. Damit soll dem „fast unbekannten, vergessenen Enkel ein kleines Denkmal“ gesetzt werden. Und dagegen kann das Goethe Institut eigentlich nichts haben, denn es pflegt ja die Erinnerung an den großen Opa, Johann Wolfgang von Goethe.
Nach dem ersten Schrecken hat sich Müller wieder gefangen. Um seinen guten Willen zu demonstrieren, hat er auf der Homepage von www.geysir.com sein Projekt umbenannt. Es heißt nun „Walther von Goethe Foundation Reykjavik“, nach dem letzten Enkel von Goethe, der an seinem Großvater gelitten hat. Damit soll dem „fast unbekannten, vergessenen Enkel ein kleines Denkmal“ gesetzt werden. Und dagegen kann das Goethe Institut eigentlich nichts haben, denn es pflegt ja die Erinnerung an den großen Opa, Johann Wolfgang von Goethe.
Am 11. Mai will Wolfgang Müller die erste „Zweigstelle“ des neuen, dem Enkel gewidmeten Goethe Instituts eröffnen, im Friseursalon „Beige“ in der Auguststraße in Berlin-Mitte, wo er sich sonst die Haare schneiden läßt. Die Eröffungsansprache wird der isländische Botschafter in Berlin, Ingimundur Sigfusson halten. Der fürchtet weder eine „Verwechslungsgefahr“, noch sieht er einen Eingriff in einen „eingerichteten Gewerbebetrieb“. Im Gegenteil. „Ich schätze sehr, was Müller macht“, sagt der Botschafter, „obwohl er manchmal ein bißchen verrückt ist. Und ich wünsche ihm viel Erfolg“.
tno