Jürgen Habermas wurde am 14. November auf dem Petersberg bei Bonn der Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2006 verliehen. Der 77-Jährige gilt als der meistbeachtete und prägendste deutsche Philosoph der Gegenwart. Bekannt wurde er, als er 1964 Horkheimer auf dessen Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt / Main folgte. 1983 nahm Habermas den Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Frankfurt an, 1994 wurde er dort emeritiert. Lesen Sie hier Ausschnitte seiner Rede zur Preisverleihung:
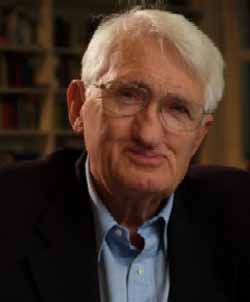 Die Rückwendung zum Nationalstaat hat in vielen Ländern eine introvertierte Stimmung gefördert: Das Europa-Thema ist entwertet, man beschäftigt sich lieber mit der nationalen Agenda. Bei uns umarmen sich in den Talkshows Großväter und Enkel in der Rührung über den neuen Wohlfühlpatriotismus. Die Gewißheit heiler nationaler Wurzeln soll eine wohlfahrtsstaatlich verweichlichte Bevölkerung für den globalen Weltkampf „zukunftsfähig“ machen. Diese Rhetorik paßt zum gegenwärtigen Zustand einer sozialdarwinistisch enthemmten Weltpolitik.
Die Rückwendung zum Nationalstaat hat in vielen Ländern eine introvertierte Stimmung gefördert: Das Europa-Thema ist entwertet, man beschäftigt sich lieber mit der nationalen Agenda. Bei uns umarmen sich in den Talkshows Großväter und Enkel in der Rührung über den neuen Wohlfühlpatriotismus. Die Gewißheit heiler nationaler Wurzeln soll eine wohlfahrtsstaatlich verweichlichte Bevölkerung für den globalen Weltkampf „zukunftsfähig“ machen. Diese Rhetorik paßt zum gegenwärtigen Zustand einer sozialdarwinistisch enthemmten Weltpolitik.
Nun wird uns Europa-Alarmisten entgegengehalten, daß eine Vertiefung der europäischen Institutionen weder nötig noch möglich sei. Die Antriebe zur europäischen Einigung seien aus gutem Grunde erschöpft, nachdem die Ziele des Friedens zwischen den europäischen Völkern und der Herstellung eines gemeinsamen Marktes erreicht seien. Außerdem zeige sich am Fortbestehen der nationalstaatlichen Rivalitäten die Unmöglichkeit einer politischen Vergemeinschaftung, die über nationale Grenzen hinausgreift. Ich halte beide Einwände für falsch. Lassen Sie mich zunächst die drängenden und mit erheblichen Risiken belasteten Probleme nennen, die ungelöst bleiben, wenn wir auf der Hälfte des Weges zu einem politisch handlungsfähigen und demokratisch verfassten Europa stehen bleiben.
Das erste, längst bekannte Problem ist eine Folge dieser Halbherzigkeit: Die europäischen Mitgliedstaaten haben im Zuge der europäischen Einigung an demokratischer Substanz verloren. Immer zahlreichere und immer wichtigere politische Entscheidungen fallen in Brüssel und werden zu Hause in nationales Recht nur noch „umgesetzt“. Der ganze Prozeß läuft an den politischen Öffentlichkeiten der Mitgliedstaaten vorbei, obgleich die europäischen Bürger nur hier ihre Stimme erheben können – eine europäische Öffentlichkeit gibt es nicht. Dieses demokratische Defizit erklärt sich aus Mängeln der inneren politischen Verfassung Europas. Das nächste Problem beleuchtet die Unfähigkeit der Europäer, nach außen geschlossen aufzutreten.
Nachdem die Regierung in Washington ihre moralische Autorität verspielt hat, zieht die Europäische Union Erwartungen der internationalen Gemeinschaft auf sich, die sie ohne eine gemeinsame Außenpolitik nicht erfüllen kann. Zwar kann sich im Nahen Osten die Diplomatie nun zum ersten Mal seit 1948 auf die Präsenz einer dritten Partei stützen, die mit einem robusten UN-Mandat ausgestattet ist. Aber die europäischen Regierungen sind aufeinander eifersüchtig und preschen alleine vor, statt ihrem Chefdiplomaten Solana mit einer gemeinsamen Agenda den Rücken zu stärken. Im 60. Jahr der Wiederkehr der Nürnberger Prozesse versagt das zerrissene Europa vor allem bei der überfälligen Reform der Vereinten Nationen. Wenn überhaupt jemand, dann könnten allein die Europäer ihre amerikanischen Verbündeten davon abbringen, die einzige legitime, von den USA selbst initiierte Weltordnungskonzeption immer wieder zu durchkreuzen, nämlich die Fortentwicklung des klassischen Völkerrechts zu einer politisch verfaßten Weltgesellschaft.
Auch das dritte Problem, die fortschreitende Unterminierung menschenwürdiger sozialer Standards, kann von den nationalen Regierungen nicht mehr im Alleingang gelöst werden. Die richtige Kritik an den Lebenslügen einer neoliberalen Orthodoxie kann ja nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich die obszöne Verquickung von steigenden Aktienkursen und Massenentlassungen einer zwingenden betriebswirtschaftlichen Logik verdankt. Daran läßt sich innerhalb des nationalen Rahmens nicht viel ändern, weil das Verhältnis von Politik und Markt weltweit aus der Balance geraten ist. Erst eine Europäische Union, die außenpolitisch handlungsfähig würde, könnte auf den Kurs der Weltwirtschaftspolitik Einfluß nehmen. Sie könnte die globale Umweltpolitik vorantreiben und erste Schritte auf dem Wege zu einer Weltinnenpolitik machen. Damit könnte sie anderen Kontinenten für den Zusammenschluß von Nationalstaaten zu supranationalen Mächten ein Beispiel geben. Denn ohne „global players“ dieser neuen Art kann ein Gleichgewicht zwischen Subjekten eines gerechteren Weltwirtschaftsregimes nicht entstehen.
Das vierte Problem, das uns auf den Nägeln brennt, ist die fundamentalistische Zuspitzung des kulturellen Pluralismus im Inneren unserer Gesellschaften. Das Problem haben wir viel zu lange aus der Perspektive der Einwanderungspolitik behandelt; in Zeiten des Terrorismus droht es, nur noch in Kategorien der inneren Sicherheit bearbeitet zu werden. Aber die brennenden Autos in den Banlieues von Paris, der einheimische Terror der unauffälligen Jungs aus den englischen Immigrantenvierteln, die Gewalttätigkeiten an der Rütli-Schule haben uns darüber belehrt, daß es mit dem Polizeischutz für die Festung Europa nicht getan ist. Die Kinder und Kindeskinder der ehemaligen Immigranten sind längst ein Teil von uns. Und weil sie es doch nicht sind, stellen sie für die Zivilgesellschaft und nicht für den Innenminister eine Herausforderung dar. Es geht darum, die Angehörigen fremder Kulturen und fremder Religionsgemeinschaften gleichzeitig in ihrem Anderssein zu respektieren und in die staatsbürgerliche Solidarität einzubeziehen.
Auf den ersten Blick hat das Integrationsproblem mit der Zukunft der Europäischen Union nichts zu tun, denn damit muß jede nationale Gesellschaft auf ihre Weise umgehen. Und doch könnte hier auch der Schlüssel für die Auflösung einer ganz anderen Schwierigkeit liegen. Der zweite Einwand der Euroskeptiker hieß ja, daß es die Vereinigten Staaten von Europa niemals geben könne, weil diesem Gebilde der Unterbau eines europäischen Volkes fehle. In Wahrheit geht es um die Frage, ob eine transnationale Erweiterung der staatsbürgerlichen Solidarität quer durch Europa möglich ist. Eine gemeinsame europäische Identität wird sich aber umso eher herausbilden, je mehr sich im Inneren der einzelnen Staaten das dichte Gewebe der jeweiligen nationalen Kultur für die Einbeziehung der Bürger anderer ethnischer oder religiöser Herkunft öffnet. Integration ist keine Einbahnstraße; sie versetzt, wenn sie gelingt, die starken nationalen Kulturen so in Schwingung, daß diese gleichzeitig nach innen und nach außen poröser, aufnahmefähiger und sensibler werden. Je mehr beispielsweise in der Bundesrepublik das Zusammenleben mit Bürgern türkischer Herkunft zu einer Selbstverständlichkeit wird, umso besser können wir uns auch in die Lage anderer europäischer Bürger – in die fremde Welt des Weinbauern aus Portugal oder des Klempners aus Polen – einfühlen. Die innere Öffnung in sich verkapselter Kulturen öffnet diese auch füreinander.
Das Integrationsproblem trifft gerade die europäischen Nationalstaaten an einem wunden Punkt. Diese haben sich nämlich über die forcierte Herstellung eines romantisch inspirierten, ältere Loyalitäten aufsaugenden Nationalbewußtseins zu demokratischen Rechtsstaaten entwickelt. Ohne die bewegende Kraft des Nationalismus wären die Bayern und die Rheinländer, die Bretonen und die Okzitanier, die Schotten und die Waliser, die Sizilianer und die Kalabresen, die Katalanen und die Andalusier kaum zu Bürgern einer demokratischen Nation verschmolzen. Wegen dieses engmaschigen und leicht entzündbaren Gewebes reagieren die ältesten Nationalstaaten sehr viel empfindlicher auf Integrationsprobleme als Einwanderungsgesellschaften wie die USA oder Australien, von denen wir eine Menge lernen können.
Ob es sich um die Integration von Gastarbeiterfamilien oder von Bürgern aus den ehemaligen Kolonien handelt – die Lektion ist immer dieselbe: keine Integration ohne die Erweiterung des eigenen Horizonts, ohne die Bereitschaft, ein breiteres Spektrum von Gerüchen und Gedanken, auch von schmerzlichen kognitiven Dissonanzen zu ertragen. In den säkularisierten Gesellschaften West- und Nordeuropas kommt die Begegnung mit der Vitalität fremder Religionen hinzu. Sie verschafft auch den einheimischen Konfessionen eine neue Resonanz. Die eingewanderten Andersgläubigen sind ein Stimulus für die Gläubigen nicht weniger als für die Nichtgläubigen.
Der Muslim von nebenan, wenn ich mich auf das aktuelle Beispiel beziehen darf, drängt den christlichen Bürgern die Begegnung mit einer konkurrierenden Glaubenswahrheit auf; den säkularen Bürgern bringt er das Phänomen einer öffentlich in Erscheinung tretenden Religion zu Bewusstsein. Soweit die betroffenen Parteien nachdenklich reagieren, werden die einen an den Traditionalismus von Vorstellungen, Praktiken und Gesinnungen erinnert, die auch in christlichen Gesellschaften bis tief ins 20. Jahrhundert hinein mit Demokratie und Menschenrechten nicht gut zusammenpassten. Die anderen, die säkularen Bürger, erkennen, daß sie es sich zu leicht gemacht hatten, als sie die religiösen Zeitgenossen als Exemplare einer aussterbenden Spezies und das Grundrecht auf freie Religionsausübung als eine Sorte von Artenschutz betrachteten.
Die gelingende Integration ist ein Lernprozeß auf Gegenseitigkeit. Bei uns stehen die Muslime unter dem größten Zeit- und Anpassungsdruck. Der liberale Staat verlangt von allen Religionsgemeinschaften ohne Ausnahme, daß sie die Tatsache des religiösen Pluralismus, die Zuständigkeit der institutionalisierten Wissenschaften für säkulares Wissen und die universalistischen Grundlagen des modernen Rechts anerkennen. Er garantiert die Grundrechte, auch innerhalb der Familie. Er ahndet Gewalt, auch in der Form des Gewissenszwangs gegenüber eigenen Mitgliedern. Aber der Bewußtseinswandel, der die Verinnerlichung dieser Normen erst möglich macht, verlangt gleichzeitig eine selbstreflexive Öffnung unserer nationalen Lebensformen.
Wer diese Behauptung als „Kapitulation des Westens“ denunziert, geht dem albernen Kriegsgeschrei der liberalen Falken auf den Leim. Der eingebildete „Islamofaschismus“ ist so wenig ein handgreiflicher Gegner, wie der Krieg gegen den Terrorismus ein „Krieg“ ist. Bei uns in Europa ist die Durchsetzung der Verfassungsnormen eine so unbestrittene Prämisse des Zusammenlebens, daß der hysterische Aufruf zur Verteidigung unserer „Werte“ als die semantische Aufrüstung gegen einen unbestimmten inneren Feind erscheint. Die Bestrafung von Gewalt und die Bekämpfung von Haß verlangt ruhiges Selbstbewußtsein, aber keine Scharfmacherei. Wer die Verleihung des Nobelpreises an Orhan Pamuk wider besseres Wissen als die Affirmation eines unvermeidlichen „clash of civilizations“ ausruft, der bläst zum Kampf der Kulturen. Wir sollten George W. Bush nicht auch noch in der Militarisierung des westlichen Geistes folgen.
Die seit 2001 zunehmende kulturelle Spannung zwischen Christentum und Islam hat jüngst in Deutschland einen aufregenden, auf hohem Niveau geführten Wettstreit der Konfessionen ausgelöst. Gestritten wird über die Verträglichkeit von Glauben und Wissen. Der Papst führt die Vernünftigkeit des Glaubens auf die Hellenisierung des Christentums, Bischof Huber auf die nachreformatorische Begegnung des Evangeliums mit dem nachmetaphysischen Denken Kants und Kierkegaards zurück. Auf beiden Seiten verrät sich im Eifer des Gefechts ein Quäntchen zu viel an Vernunftstolz. Der liberale Staat muß jedenfalls darauf bestehen, daß die Verträglichkeit des Glaubens mit der Vernunft allen religiösen Bekenntnissen zugemutet wird. Diese Qualität darf nicht als die exklusive Eigenschaft einer bestimmten, an eine westliche Traditionslinie gebundenen Religion beansprucht werden.