„Was mich fasziniert, ist der Gedanke, daß etwas Geistiges
eine derartige Kraft haben kann, daß man dafür sein Leben opfert –
und gegebenenfalls auch dafür tötet“. Christoph Peters
Ägypten 1993: der Kampf fundamentalistischer Terroristen gegen die Regierung Mubarak ist in seine heißeste Phase getreten. Seit Anfang der neunziger Jahre erschüttert eine Serie spektakulärer Anschläge das Land, deren Ziel es ist, den ägyptischen Staat in seinen Wurzeln zu treffen. Denn wenn erst einmal die Touristen aus Angst um ihr Leben ausblieben, würde die Wirtschaft des Landes und damit auch das Regime von Präsident Mubarak zusammenbrechen, und eine neue, islamische Regierung könnte die Herrschaft übernehmen. Das Buch:
In den frühen Morgenstunden des 14. November 1993 bricht eine Gruppe von neun islamischen Fundamentalisten zu den Tempelanlagen von Luxor auf. Angeführt von dem im Guerillakrieg erfahrenen Samir, der schon in Afghanistan erfolgreich gegen die russischen Besatzungstruppen gekämpft hat, macht sich die Gruppe auf den Weg durch die Wüste zum Nil. Unter ihnen ist der junge Deutsche Jochen Sawatzky, der sich seit seinem Übertritt zum Islam „Abdallah“ nennt und der Arua, seine arabische Freundin, in Deutschland zurückgelassen hat, um sich in Ägypten dem bewaffneten Kampf gegen die Ungläubigen und für die Errichtung eines Gottesstaates anzuschließen.
Alles ist seit Monaten minutiös genau geplant und in höchster Geheimhaltung vorbereitet worden; nichts scheint mehr schief gehen zu können.
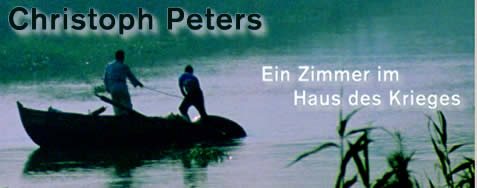
In kleinen Booten beginnen die Terroristen den Nil zu überqueren, als plötzlich klar wird, daß sie in einen Hinterhalt von Polizei und Militär geraten sind. Ob Verrat oder nicht: ihre Pläne sind offensichtlich durchgesickert. Von Schnellbooten verfolgt und aus der Luft von Hubschraubern beschossen, suchen sie Schutz in einer Bananenplantage. Doch gegen die Übermacht der Sicherheitskräfte haben sie keine Chance: Alle Terroristen werden gestellt, nur wenige, darunter Sawatzky, überleben den Kugelhagel.
Sawatzky wird in ein Gefängnis gebracht und wartet dort auf seinen Prozeß. Unterdessen laufen in der deutschen Botschaft in Kairo die Drähte heiß. Claus Cismar, der deutsche Botschafter, erstellt eilige Dosiers, um den Krisenstab im Außenministerium über die Hintergründe der Tat zu informieren. Zugleich versucht er auf allen diplomatischen Kanälen darauf hinzuwirken, daß eine Auslieferung des Bundesbürgers Sawatzky an die deutschen Behörden ermöglicht werden kann. Eine delikate Angelegenheit, die Cismars ganzes diplomatisches Geschick fordert.
Bald schon stellt Cismar freilich fest, daß ihn die Angelegenheit über das professionell Notwendige hinaus beschäftigt, daß er ein tiefes persönliches Interesse verspürt, hinter die Motive des jungen Deutschen zu kommen. Der Fall erschüttert ihn in seinem Innersten, und das nicht nur, weil er in einer latenten Lebenskrise steckt und seine Ehe gerade zu zerbrechen droht. Der Fall erschüttert ihn vielmehr, weil Cismar der der 68er-Bewegung entstammt und einst zum Sympathisantenkreis der RAF gehörte. Den fanatischen Absolutheitsanspruch Sawatzkys und den Glauben an die Legitimität und Notwendigkeit von Gewalt zur Durchsetzung einer höheren Wahrheit und neuen Gesellschaftsordnung kennt er nur zu gut, auch wenn er sich schon vor Jahrzehnten von diesen ideologischen Ansätzen losgesagt hat.
Der Fall Sawatzky berührt und bedroht auf diese Weise die Fundamente von Cismars Identität und Lebensentwurf; er stellt ihn vor die Frage, wie sehr er die Ideale seiner Jugend verraten hat. Und wie sehr er selbst Teil des Systems geworden ist, das er früher gehaßt hat.
Christoph Peters hat mit „Ein Zimmer im Hause des Krieges“ einen sprachlich virtuosen und tiefgründigen Roman über den Zusammenprall von Orient und Okzident, von christlich-westlicher und islamisch-arabischer Welt vorgelegt. Brillant geschrieben, kreist „Ein Zimmer im Haus des Krieges“ um hochaktuelle Fragen wie jene nach modernem Werterelativismus und religiösem Absolutheits- und Erlösungsanspruch, nach dem Verhältnis von Religion und Staat, nach der Legitimität von Gewalt im Dienste einer (vermeintlich) höheren Wahrheit. Christoph Peters geht es dabei nicht darum, vorschnell Position zu beziehen; er möchte das Phänomen des islamischen Fundamentalismus nicht be- oder verurteilen, sondern es verstehen und in seiner immanenten Logik einsichtig machen. Und er möchte eine Ahnung davon vermitteln, wie Menschen „funktionieren“, die eine solche Glaubensgewißheit und Entschlossenheit haben wie Sawatzky. Das macht die besondere Faszination und Brisanz dieses Buchs aus, das Peters seit nahezu zehn Jahren beschäftigt und mit dem er sich einmal mehr als eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur erweist.